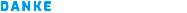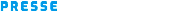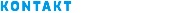Was:
Hortfund mit 66 Spangenbarren aus Bronze
Wann:
Ca. 1800 v. Chr. (Frühbronzezeit)
Wo:
Bermatingen-Ahausen, „Unterwald” beim Hof Unter-Reidern
Was:
Horfund mit Bronzegegenständen
Wann:
16. - 9. Jh. v. Chr. (Mittel- bis Spätbronzzeit)
Wo:
Deggenhausertal-Homberg, beim "Akenbacher Hof"
Was:
Lanzenspitze aus Eisen
Wann:
7./8. Jh. n. Chr.
Wo:
Privatgrundstück Kroschewski,
unterhalb der Weingartenkapelle, Frickingen
Was:
Mischwesen aus Bronze
Wann:
9. Jh. v. Chr. (Spätbronzezeit/Urnenfelderzeit)
Wo:
Hagnau-Burg, Pfahlbau
Was:
Gefäßscherben aus Keramik
Wann:
16. - 9. Jh. v. Chr.
(Mittel- bis Spätbronzezeit)
Wo:
Heiligenberg-Altheiligenberg
Was:
Radanhänger und Dreiecksanhänger
aus Bronze
Wann:
1300 - 900 v. Chr. (Spätbronzezeit/Urnenfelderzeit)
Wo:
Immenstaad
Was:
Steinbeil aus Amphibolit
Wann:
3850 - 3400 v. Chr. (Jungsteinzeit)
Wo:
Meckenbeuren,
Kehlen-Siglishofen
Was:
Geweihstück mit
zwei Bohransätzen
Wann:
4./3. Jt. v. Chr. (Jungsteinzeit,
Zeit der Pfahlbauten)
Wo:
Meersburg-Haltnau
Was:
Medaillons
V.l.n.r.:
Scheyrer Kreuz,
Maria Trost,
Dorfen/Altötting
Wann:
18. Jh. n. Chr.
Wo:
Neukirch
Was:
Grabbeigaben (Keramik, Eisensschwert)
Wann:
8./7. Jh. v. Chr. (Hallstattzeit)
Wo:
Oberteuringen
Was:
Gefäßscherben
aus Keramik
Wann:
3500 - 1500 v. Chr.
(Stein- bis Bronzezeit)
Wo:
Owingen-Billafingen, Brunnenbühl
Was:
Grabbeigaben (Keramik, Bornzefibel)
Wann:
8./7. Jh. v. Chr. (Hallstattzeit)
Wo:
Salem, Hardtwald
Was:
Feuersteinklinge mit Holzgriff aus Esche
Wann:
3400 - 2800 v. Chr. (Horgener Kultur)
Wo:
Pfahlbausiedlung Sipplingen-Osthafen
Bermatingen
Europäischer Fernhandel vor 4000 Jahren
Funde von Rohmaterialien belegen Handelsbeziehungen quer durch Europa
1921 wurden beim Ausgraben einer Baumwurzel nahe des Hofs Unter-Riedern im „Unterwald” bei Bermatingen-Ahausen 66 sogenannte Spangenbarren aus Bronze gefunden. Es handelt sich hierbei um eine während der entwickelten Frühbronzezeit (Bz A2a, etwa 19./18. Jh. v. Chr.) hauptsächlich in Süddeutschland, teilweise bis hin zur Elbe verbreiteten Rohbarrenform. Der Fund wog insgesamt etwa 5,4 kg. Da von 42 der 66 Barren bereits Teile abgebrochen waren, dürfte das ursprüngliche Gewicht höher gewesen sein. Ein einzelner Barren ist rund 30 cm lang und durchmisst bei verschiedenen Querschnitten etwa 1 bis 1,5 cm, wobei die beiden leicht verdickten Enden etwa rechtwinklig umgebogen worden sind.
Poröse Oberflächen, Gussblasen und andere Mängel lassen annehmen, dass die Stücke in sehr einfacher Weise hergestellt wurden. Vermutlich hatte man das geschmolzene Metall lediglich in eine in Lehm oder Sand gezogene Rille gegossen. Vor dem endgültigen Aushärten wurden die Enden umgebogen, um ihren Transport in Bündeln zu erleichtern.
In dieser weitgehend standardisierten Form gelangte das Rohmaterial aus den alpinen Lagerstätten in das süddeutsche Voralpenland. Obwohl die Archäologie nach klassischer Stufeneinteilung schon gut 300 Jahre zuvor die „Bronzezeit” beginnen lässt, wird die Legierung des Kupfers mit anderen Metallen, besonders mit Zinn zur Bronze, erst im jüngeren Verlauf der Frühbronzezeit häufiger greifbar. Von Süden kommend, dürften die Bermatingener Spangenbarren über die Systeme des Alpen- oder Hochrheins an den Bodensee gelangt sein. Stark befestigte Pfahlbausiedlungen an dessen Süd- und Nordufer sowie auf der Halbinsel des Bodanrück im westlichen Bodenseeraum kontrollierten den Transport von Rohmaterial und Fertigwaren über das Wasser. Oberhalb einer Schleife der Seefelder Aach gelegen, könnten die Spangenbarren aus der Ufersiedlung bei Unteruhldingen „Stollenwiesen” landeinwärts transportiert worden sein.
Im Abstand von durchschnittlich etwa 11 km zueinander sind hier frühbronzezeitliche Siedlungen bekannt, die jeweils in Spornlage den Austritt von nach Süden fließenden Gewässern aus der Oberschwäbischen Hügellandschaft in das Bodenseebecken besetzten. Wenig flussaufwärts gabelt sich im Salemer Becken die Deggenhauser von der Seefelder Aach ab. Bestens zu überblicken war dieser natürliche Kreuzungspunkt von der Höhensiedlung auf dem „Altheiligenberg” bei Frickingen. Von hier aus konnte sowohl über Seefelder Aach/Nußbach und Kehlbach als auch über Deggenhauser Aach zunächst die Wasserscheide, von dort aus dann flussabwärts über Andelsbach und Ablach die Donau erreicht werden.
Ein vergleichbarer Fund von 46 frühbronzezeitlichen Spangenbarren ist nahe der Rotach bei Friedrichshafen gemacht worden. In gleicher Weise vermittelt er über Rotach und Ablach bis hin zur Donau. Funde wie die Spangenbarren aus Bermatingen stehen also stellvertretend für ein weitläufiges Beziehungssystem, in welchem die Region Bodensee/Oberschwaben an vermittelnder Stelle zwischen den großen europäischen Gewässersystemen von Donau und Rhein steht. Mit Sicherheit hat man in dieser Region neben der eigenen, landwirtschaftlichen Produktion in kleinen, ländlichen Tal- oder Hangsiedlungen nicht zuletzt auch vom Umschlag eben dieses Rohmaterials und seiner Gegenwerte gelebt.
Text: Benjamin Höpfer, Institut für Ur- und Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Rosgartenmuseum Konstanz
Foto: PM/Schellinger
Daisendorf
Geheime Zeugen am Wegesrand
Ein Stein erzählt von Herrschaft und Besitz
Warum Grenzsteine?
Jeder, der ein Grundstück besitzt, hat sie: Grenzsteine. Sie sind ein Kulturgut mit hohem juristischem und historischem Wert. So war es schon im Jahr 1659. Ein Gewirr von Grenzen durchzog damals den Bodenseeraum. Die Grenzen wurden durch mündliche Absprachen und Urkunden gesichert. Zu den mächtigsten Grundbesitzern am Bodensee gehörten der Bischof von Konstanz und die Reichsabtei Salem. Für die Menschen waren aber nur die Grenzen in der Landschaft deutlich. Diese Grenzen wurden durch spezielle Steine, sogenannte Grenzsteine markiert. Wenn eine Grenze einen bestimmten Rechtsbereich umschloss, wurde sie durch solche Grenzsteine sichtbar gemacht. Die Steine, die als rechtlich verbindlich galten, standen unter einem besonderen Schutz. Sie gaben auf den Zentimeter genau an, wo die Grenzen zwischen den Eigentümern damals verliefen.
Der Grenzstein von 1659 vom „Entenweiher”
Der hier ausgestellte Grenzstein wurde von Siegfried Knauer aus Daisendorf auf einem Steinhaufen 250m südlich vom „Entenweiher” in Oberriedern gefunden. Er zeigt an der beschädigten Seite das Wappen des Hochstifts Konstanz mit der Jahreszahl 1659, daneben steht „ST M” für „Stadt Meersburg”. Die zweite Seite trägt dasselbe Wappen und die Buchstaben „G D”. Sie stehen für Gemeinde (G) Daisendorf (D). Auf der dritten Seite sind der Salemer Abtsstab und die Zahl 18 zu sehen. Der Stein markierte einst die Grenze zwischen Daisendorf, Mühlhofen und Meersburg. In Meersburg hatte der Konstanzer Bischof Besitzungen, in Mühlhofen hatte der Abt das Sagen. Die Zahl 18 diente der regelmäßigen Kontrolle der Steine, die zur einfacheren Zählung eine Nummer bekamen. Dieser Stein ist in einer Karte von Johann Jacob Heber aus dem Jahr 1699 eingezeichnet.
Warum findet man Eierschalen unter Grenzsteinen?
Grenzsteine durften nur von angesehenen Bürgern gesetzt werden. Unter den bis zu 150 kg schweren Stein legten sie ein Muster aus Dachziegeln, Glasböden oder Eierschalen – ein Muster, das nur sie kannten. Diese Muster halfen, dass die Grenze nicht unbemerkt versetzt wurde. Wurde dagegen verstoßen, gab es teils drastische Strafen wie das Abtrennen der Hand, die man zum Umsetzen des Grenzsteins brauchte. Früher wurden regelmäßig Umgänge veranstaltet. Die Bürger marschierten der Grenze entlang und schauten, ob die Grenzsteine noch standen und prägten sich so auch gleich den genauen Verlauf der Grenze ein.
Bevor es Grenzsteine gab, markierten natürliche Zeichen wie Steine, Felsen und Wege, insbesondere aber Bäume die einst vorhandenen Grenzen. In diese Bäume, die an gut sichtbaren Stellen standen, wurde ein Zeichen eingehauen, ein sogenanntes Mal. Als die natürlichen Grenzzeichen nicht mehr ausreichten, wurden diese von Grenzsteinen abgelöst.
Beim Umfang durch die Flur gab es auch das Ritual, bei bestimmten Grenzsteinen den Buben eine Ohrfeige zu geben, damit sie sich von klein an den Ort merkten und ein Leben lang auch nicht mehr vergaßen. Daher soll auch der Ausdruck „hinter die Ohren schreiben” stammen. Die Grenzsteine konnten durch Hochwasser, Unwetter und Erdbewegungen zerstört werden. Heutzutage sind Traktoren die größten Gefahren dieser Geschichtszeugen, aber auch das fehlende Wissen um ihre Bedeutung.
Text: Dr. Matthias Baumhauer, Pfahlbaumuseum Unteruhldingen
Leihgeber: Diethard Nowak, Meersburg
Foto: PM/Nowak
Deggenhausertal
Zweimal für die Nachwelt vergraben
Pfahlbauer respektieren die Vermächtnisse ihrer Ahnen
Der Bronzehort von Akenbach, benannt nach seinem Fundort bei den Akenbachhöfen auf Gemarkung Deggenhausertal-Homberg, stellt einen der umfassendsten bronzezeitlichen Funde im hinterland des UNESCO-Weltkulturerbe der Pfahlbauten dar. Bereits 1821 beim Wegräumen eines beim Pflügen hinderlichen Steins durch den Bauern entdeckt, wurden die Funde an verschiedene Interessenten verschenkt, als klar war, dass es sich wohl nicht um wertvolles Gold handelte. Nach Aussage des Finders war man in „fast einem Schuh” Tiefe auf einen „bauchigen Hafen” gestoßen, darauf ein „grosser, gegossener Brocken Metall” und darin schließlich die „übrigen Metallstücke, bis 100 Pfund schwer”.
Von dem Tongefäß sind keinerlei Reste überliefert, die verstreuten Bronzeobjekte konnten aber durch Einschreiten des damaligen Großherzoglichen Bezirksamts in Meersburg zum Teil wieder eingesammelt und für die Fürstlich Fürstenbergische Altertümersammlung erworben werden. So sind heute immerhin 72 Einzelstücke dieses großen Depotfundes bekannt. So nennt die heutige Archäologie Funde, die nicht in Zusammenhang zu Siedlungen oder Bestattungen stehen, offenbar aber bewusst deponiert wurden. Je nach ihrer Zusammensetzung und der räumlichen Lage ihres Fundorts werden sie zum Teil als profane Niederlegungen, womöglich von reisenden Händlern versteckte Waren, oder als Symbolträger kultischer Handlungen, Opfer- oder Weihegaben, interpretiert.
Der Akenbacher Fund besteht neben den rohen Gussbrocken zum Großteil aus stark abgenutzten und zerbrochenen Bronzewerkzeugen und -waffen: Schwerter, Lanzen, Beile, Sicheln. Daneben finden sich etliche Schmuck- oder Trachtbestandteile: Gewandnadeln, Zierscheiben und Blechbänder. Sie entsprechen den üblichen Beigaben von Gräbern der frühen Hügelgräberbronzezeit (etwa 16. Jh. v. Chr.). In dieser Zusammensetzung ist der Fund als sogenannter Brucherzhort anzusprechen, in dem die Gußbrocken und Altstücke vermutlich zur späteren (versäumten) Wiederverwertung versteckt wurden. Er könnte einem Bewohner eines Pfahlbaudorfes oder einer der umliegenden Höhensiedlungen gehört haben, welche vermutlich die Verkehrswege nach Norden Richtung Donau und Schwäbischer Alb kontrollierten.
Bemerkenswert sind mehrere Beilklingen und zwei kleine Vogelfigürchen, die deutlich jünger sind und an das Ende der spätbronzezeitlichen Urnenfelderkultur (9. Jh. v. Chr.) gehören. Besonders die Ansteckvögel weisen in eine kultisch-rituelle Richtung. In gleicher Form sind sie etwa als Achsnägel sogenannter Kultwägen bekannt, das Vogelmotiv an sich erscheint häufig auf religiösen Darstellungen der Bronzezeit. Was die Zugehörigkeit dieser weitaus jüngeren Stücke angeht, muss in diesem Fall zwar der Detektivarbeit der Großherzoglichen Bezirksbeamten vertraut werden, vergleichbare Ansteckvögel finden sich aber immer wieder zusammen mit älterbronzezeitlichen Depotfunden. Es scheint also, als sei auch hier in der späten Bronzezeit ein rund 700 Jahre altes, vergessenes Händlerversteck zufällig entdeckt worden. Es bleibt dann aber die Frage, wieso man nicht einfach dem ursprünglichen Zweck gefolgt war, das Material einzuschmelzen, um eigene, moderne Werkzeuge oder Schmuckgegenstände daraus zu gießen. Glaubte man darin die Vermächtnisse der Ahnen zu erkennen, ergänzte den Fund um die eigenen religiösen Symbole und vergrub ihn an dieser landschaftlich so markanten Stelle oberhalb der Rotach erneut?
Text: Benjamin Höpfer, Institut für Ur-Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Archäologisches Museum Colombischlössle, Städtische Museen Freiburg
Foto: Konservierungslabor Konstanz/Riens
Eriskirch
Über drei Brücken mussten sie gehen
Römische Funde aus dem alten Schussenbecken in Eriskirch
Die Funde
Im Jahre 1906 stieß man bei der Begradigung der Schussen im Nordosten von Eriskirch auf die Überreste von 137 Pfählen aus Eichenholz. Durch diese konnten drei römische Holzbrücken rekonstruiert werden. Zwischen den Pfählen fand man aber auch einige römische Fundstücke. Neben Keramik, vielen Tierknochen, kleineren Metallfunden und fünf römischen Münzen wurden eine Axt, ein Messer, eine Lanzenspitze, ein Zügelring, ein Schlüssel, vier Fibeln sowie eine bronzezeitliche Axt gefunden.
Diese Objekte wurden in der Antike von ihren Besitzern verloren, oder als Opfergaben absichtlich im Fluss versenkt. Solche Opfer in Flüssen oder Seen sind sowohl für die Römerzeit als auch für die Vorgeschichte nichts Ungewöhnliches und wurden oft praktiziert. In diesem Zusammenhang könnte möglicherweise auch die dort gefundene bronzezeitliche Axt zu sehen sein.
Das römische Eriskirch
In Eriskirch bestand eine der wenigen bekannten, dorfartige Siedlung des nördlichen Bodenseeufers. Die Region gelangte im Jahre 15 v. Chr., während der Herrschaft von Kaiser Augustus unter römische Kontrolle. Ab etwa 50 n. Chr. wurde unter Kaiser Claudius die Provinz Raetia eingerichtet, die es bis 254 n. Chr. gab, und der auch der Bereich des nördlichen Bodenseeraumes angehörte. Ihre Hauptstadt war zunächst das heutige Kempten und später Augsburg. Während es sich bei römischen Siedlungsspuren meist um sogenannte villae rusticae (Gutshöfe mit landwirtschaftlicher Prägung) handelt, von denen 16 in der Region bekannt sind, ist die Existenz von kleineren römischen Siedlungen (sog. vici) kaum belegt. Die wenigen römischen Spuren im nördlichen Bodenseeraum sind möglicherweise damit zu erklären, dass die Gegend in dieser Zeit wohl nur dünn besiedelt war. Viel schwerer ins Gewicht fällt hierbei jedoch der schlechte Forschungsstand in der Region.
Die Brücken von Eriskirch sind eine der wenigen nachgewiesenen römischen Brücken in Oberschwaben. Es handelt sich hierbei wohl um drei verschiedene Brücken aus unterschiedlichen Zeiten. Dabei kann man zwei unterschiedliche Ausrichtungen feststellen, die für eine Verlagerung der Straßenführung in späterer Zeit sprechen. Die Brücken zeigen, dass hier wahrscheinlich die römische Straße des nördlichen Bodenseeufers verlaufen ist. Dabei deutet sich auch die verkehrsgünstige Lage der Siedlung an: im Süden war sie an den Bodensee angeschlossen (einer der wichtigsten Verkehrswege der Region), im Norden an einen Verkehrsweg über die Schussen und die Riß bis hin zur Donau. Außerdem lag sie an einer Straße, die in Ost-West-Richtung verlief, welche durch die Brücken nachgewiesen ist. Damit lag die Siedlung genau an der Kreuzung dieser Verkehrsachsen.
Neuere Forschung
Bei neueren Grabungen und Feldbegehungen in und um Eriskirch kamen weitere römische Siedlungsspuren zum Vorschein. Darunter Reste von Öfen und holzverschalten Gruben, Pfostengruben und Kulturschichten. Aufgrund der guten Erhaltung im nassen Boden konnte man Reste der Bretterverschalungen von Gruben oder die untersten Reste von Holzpfählen bergen. Die Datierung eines Holzbretts lieferte dabei ein Fälldatum von etwa 78 n. Chr. Hierdurch, durch die Münzen und die Keramik deutet sich ein Schwerpunkt der Siedlung im Zeitraum von 70 bis 120 n. Chr. an. Wann das Ende der Siedlung eintrat, ist bisher noch unklar.
Text: Andrej Girod, Institut für Ur- und Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Landesmuseum Württemberg, Stuttgart
Foto: Sonja Hommen, Landesmuseum Württemberg, Stuttgart
Fischbach
Steinalt und doch brandaktuell
Steinzeitliche Funde aus Friedrichshafen-Fischbach
In Friedrichshafen-Fischbach wurden im Gewann Hubstöckle in den frühen 1950er Jahren Lagerplätze der mittelsteinzeitlichen Jäger und Sammler gefunden, die sich zwischen ca. 8000 und 6000 v.Chr. dort aufhielten. Der Großteil des Fundmaterials besteht aus z. T. sehr kleinen Feuersteinobjekten. Diese waren ursprünglich in Holz-, Knochen- oder Geweihgriffen befestigt.
Die mittelsteinzeitlichen Menschen nutzten organische Materialien wie dünne Zweige oder Baumbaste zu Herstellung von Körben, Reusen, Matten oder Kleidung. Die Steingeräte von Friedrichshafen-Fischbach bestehen aus Feuerstein (Silex), der häufig von der Schwäbischen Alb geholt wurde. Sie sind oft sehr klein und unscheinbar. Es handelt sich um Klingen für Messer, die vor allem beim Zerteilen der Jagdbeute benötigt wurden. Pfeilspitzen sind Beleg für die Jagd mit Pfeil und Bogen, mit Bohrspitzen wurden Gebrauchsgegenstände wie Schmuckstücke aus Stein, Knochen und Geweih oder Leder gelocht.
Wichtig bei der Bearbeitung von Tierhäuten waren Schaber und Kratzer. Mit ihnen wurden die Häute erlegter Tiere von Fleischresten und Fett gereinigt, um sie anschließend im Rauch zu gerben. Danach konnten sie zu Kleidung weiter verarbeitet werden.
Die aus Fischbach ausgestellten Silexartefakte sind z. T. dreieckig, oft rechteckig mit gerader oder leicht geschwungener Basis. Die Kanten waren teilweise durch Abdrücken kleiner Splitter geformt und geschärft (retuschiert). Damit wurden sie auch stabiler. Dies war insbesondere für Jagdpfeilspitzen wichtig.
Der Seespiegel des Bodensees lag vor 10.000 Jahren wesentlich höher als heute und so finden sich die Lagerplätze der Menschen dieser Zeit vor allem entlang der 400 m Höhenlinie, damals das Ufer des Sees. Der Bodensee war in der Mittelsteinzeit ein begehrtes Jagdgebiet der umherziehenden kleinen Jäger- und Sammlergruppen. Er lieferte Fisch, in den ufernahen Auenwäldern lebten zahlreiche Tiere und es gab Viel zu sammeln: Beeren, Pilze, Wurzeln, Blätter, Kräuter. Über den See verliefen schon damals wichtige Verkehrsrouten. Mit Einbäumen konnte man schnell entfernte Gebiete erreichen. Auch das Wasser selbst war eine zentrale Ressource, die das Überleben sicherte.
Text: Redaktion Pfahlbaumuseum/Lukas Horch, Institut für Ur-Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Pfahlbaumuseum Unteruhldingen
Foto: PM/Schellinger
Frickingen
Heidenkrieger oder Gottesstreiter?
Die Frickinger Lanze gibt spannende Rätsel über ihren früheren Träger auf
Die Eisenlanze ist weit über 1000 Jahre alt. Sie datiert ins 7.- 8. Jh. und damit in die Zeit der alemannischen Herzöge im heutigen Südwestdeutschland. Hubertus Kroschewski fand sie im September 1968 bei Erdarbeiten zu seinem Haus unweit der Weingartenkapelle in Frickingen. Die Lanzentülle weist eine gleichmäßige Rautenverzierung auf. Lanzen wie diese waren kostbare Statussymbole. Nur reiche und hochrangige Personen konnten sie sich leisten. Entweder wurden sie an die nächste Generation weitergegeben oder aber mit ihrem Besitzer bestattet. Vergleichbare Funde aus ganz Europa lassen vermuten, dass es sich bei ihrem Träger um einen 20- bis 50-jährigen Adeligen handelte. Die Lanze wurde einzeln, ohne weitere Funde entdeckt. Das lässt Raum für viele Interpretationen. Mit wem haben wir es hier zu tun?
Der Fundort nahe der Kapelle könnte nicht zufällig sein. Zwar stammt der heutige Kirchenbau aus dem 16. Jh., doch ist es möglich, dass sich an dieser Stelle bereits vorher Sakralbauten befanden. Wurde in ihrer Nähe ein alemannischer Christ beerdigt? Schließlich war die alemannische Elite ein früher Förderer des Christentums. Hügel und Hänge dienten bereits in vorchristlicher Zeit als Begräbnisstätten. Der Hügel, auf dem die heutige Weingartenkapelle steht, ist die höchste Erhebung in Frickingen. Möglich ist, dass sich ein Adeliger am Hang dieses markanten Landschaftsmerkmals beerdigen ließ. Oder starb der Lanzenträger im Kampf? Funde aus der nahen Burg Altheiligenberg lassen vermuten, dass hier bereits im Frühmittelalter eine Ansiedlung existierte. Spätestens ab dem 10. Jh. ist sie urkundlich belegt. Vielleicht war der Kämpfer an einer Auseinandersetzung in ihrer Nähe beteiligt, in der er den Tod fand.
Das heutige Südwestdeutschland machte im Frühmittelalter vielfältige Veränderungen durch. Große Teile gelangten ab dem 6. Jh. unter die Herrschaft der fränkischen Merowingerkönige. Unter Chlothar II. und seinem Sohn Dagobert I. (beide Anfang des 7. Jh.) wurden sie als Herzogtum Alemannia zunehmend in das Frankenreich eingegliedert. Die Christianisierung der örtlichen Bevölkerung spielte dabei eine wichtige Rolle. Insbesondere die Gründung des Klosters auf der Reichenau durch die Dynastie der Karolinger 724 war ein Versuch, die alemannischen Herzöge über Kirchenstrukturen weiter ihrem Machtbereich unterzuordnen. Der Niedergang der Merowingerdynastie und der Aufstieg der Familie der Karolinger hatten im Frankenreich zu Spannungen mit den alemannischen Herzögen geführt, die in der Auflösung des Herzogtums 746 gipfelten. Im sogenannten „Blutgericht zu Cannstatt” wurden, so sagt man, große Teile der alemannischen Führungsschicht durch die Karolinger hingerichtet.
Um wen genau es sich bei dem unbekannten Lanzenträger handelte, ist heute nicht mehr feststellbar. War er ein früher Christ, der sich am Hang der höchsten Erhebung Frickingens beerdigen ließ? Oder ein heidnischer Adeliger, der sich der Christianisierung zur Wehr setzte und mithalf die Missionare von der Reichenau zu vertreiben? Vielleicht hatte der Lanzenträger auch gegen Krieger im Dienste der Karolinger gekämpft, als er im heutigen Frickingen starb. Oder war er selbst ein fränkischer Kämpfer?
Die Lanze gibt viele Rätsel auf, aber dadurch macht sie die Geschichte Frickingens und darüber hinaus spannend.
Text: Julian Windmöller, Institut für Ur- und Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Hubertus Kroschewski, Frickingen/Pfahlbaumuseum Unteruhldingen
Foto: PM/Schellinger
Friedrichshafen
Keltische Münzen aus den Anfängen der Geldwirtschaft
Münzbilder weisen den Weg zu ihrer Geschichte
Ausgestellt werden zwei Münzen, die in der Umgebung von Friedrichshafen gefunden wurden und in den Privatbesitz des Sammlers von Altertümern und begeisterten Numismatikers Robert Forrer aus Straßburg gelangten. Im Krieg wurde das Archiv des Sammlers zerstört und alle Aufzeichnungen und Informationen zu den beiden Münzen sind verloren gegangen. Seit 1933 befinden sich die Stücke im Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz. Da die Münzen somit ohne Kontext sind, müssen sie heute über vergleichbare Münzfunde erschlossen werden.
Durch Größe, Gewicht und Material genormte Handelswerte gibt es bereits seit der Jungsteinzeit. Echte Münzen kommen erst in der Eisenzeit im Mittelmeerraum auf, funktionieren aber nach demselben Prinzip. Bereits früh - nämlich ab Ende des 4. Jahrhunderts vor Christus - werden im keltischen Bereich Mitteleuropas Münzen geprägt. Durch Wanderungsbewegungen, aber auch durch Krieg, kam es in dieser Zeit zu Kulturaustausch. Es ist davon auszugehen, dass Kelten auf ihrer Heimreise einzelne Münzen aus dem Mittelmeerraum über die Alpen nach Süddeutschland brachten. Bei den ersten Münzen handelt es sich deshalb auch um Nachahmungen griechischer Vorbilder, was man an den teilwiese schematisiert übernommenen Motiven von Königsportrait auf der Vorderseite und Pferd mit Reiter auf der Rückseite erkennen kann. Sie waren aus Edelmetallen zunächst aus Gold und später auch aus Silber.
Eine echte Geldwirtschaft kam jedoch erst im 2. Jahrhundert vor Christus auf. Die Münzen wurden nun aus unedlen Metallen wie Potin, einer stark zinnhaltigen Bronzelegierung, hergestellt und als Massenware gegossen.
Über die Motive und die Art der Darstellung der Bilder auf Münzen können diese zugeordnet werden. Münzfunde werden hierfür auf Basis ihrer Münzbilder in Verbreitungskarten eingetragen, welchen man dann wiederum entnehmen kann, von welchem keltischen Stamm diese geprägt worden sind. Dies funktioniert, weil die frühen Münzen nur regional in Umlauf waren. Mit zunehmender Herausbildung einer eigentlichen Geldwirtschaft wird eine solche Bestimmung schwieriger, da die Münzen über größere Distanzen gehandelt wurden.
Bei den beiden hier vorliegenden Münzen handelt es sich um Bronzemünzen, wie sie kurz vor der Jahrtausendwende aufkommen. Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite der vorliegenden Münzen weist ein Münzbild auf. Auf der Vorderseite sieht man den Kopf eines Menschen im Profil. Dieser trägt eine detailliert dargestellte Haartracht. Auf der Rückseite ist stilisiert ein galoppierendes Pferd zu sehen. Hergestellt wurden sie demnach vom keltischen Stamm der Sequaner. Sie datieren in das 1. oder 2. Jahrhundert vor Christus.
Text: Jutta-Constanze Arndt, Institut für Ur- und Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Römisch Germanisches Zentralmuseum, Mainz
Foto: Römisch Germanisches Nationalmuseum, Mainz
Hagnau
Mischwesen aus dem Bodensee
als Spiegel religiöser Vorstellungen
Wie kommt der Wasservogel zu seinen Hörnern
Im See von Hagnau am Bodensee entdeckte man 1892 einen besonderen Fund: ein kleines Bronzefigürchen in Form eines gehörnten Wasservogels. Es stammt vermutlich aus dem 9. Jh. v. Chr. und fällt somit in die Zeit der sogenannten Urnenfelderkultur (ca. 1300-800 v.Chr.). Die Urnenfelderkultur bezeichnet die Übergangsphase von der Bronze- zur Eisenzeit. Betrachtet man bisherige Erkenntnisse über den Alltag der Bauern am Bodensee im 9. Jh. v. Chr. fällt auf, dass er von wirtschaftlichen Mischformen geprägt war. Man betrieb gleichermaßen Ackerbau, Fischfang, Sammelwirtschaft wie auch Handel.
In der Kunst der Bronzezeit waren Wasservogeldarstellungen ein häufiges Motiv. Sie befanden sich auf den verschiedensten Gegenständen wie Schmuck- und Trachtbestandteilen, aber auch als Verzierungselemente bei Bestattungsbeigaben oder Alltagsgegenständen. Häufig wurden sie zusammen mit Wägen und Sonnen dargestellt. In der Eisenzeit verschwindet das Motiv der Wasservögel. Es wird nach und nach durch Tierdarstellungen mit Hörnern ersetzt. Während sie in der Urnenfelderkultur vereinzelt als Mischformen auftreten, sind sie in der Eisenzeit eindeutig als Stiere zu identifizieren. Archäologen gehen davon aus, dass hierbei religiöse Symbole dargestellt werden. Die Mischformen der Urnenfelderkultur weisen sich als „gehörnte Vogeldarstellungen” aus. Ein ähnlicher Fund wie der aus Hagnau wurde in einem Grab bei Gammertingen gemacht. Eine ca. 2,5 cm große Bronzetülle wurde in Form einer Ente mit Hörnern gestaltet. Bislang ist nicht geklärt woran die Tülle befestigt war, man geht aber von einer Miniatur-Wagen-Deichsel oder einem Aufsatz an einem Trinkhorn aus. Auch das Mischwesen von Hagnau weist einen röhrenförmigen Ansatz auf. Im Gegensatz zu der Tülle von Gammertingen sind bei diesem nicht nur die Kopfpartie sondern auch Rumpf und Schwanzbereich ausgeführt. Auffallend ist, dass der Körper eher langestreckt wirkt, die Flügel nicht ausgearbeitet sind und das Schwanzgefieder an einen Fischschwanz erinnert. Möglicherweise ist also das Hagnauer Bronzefigürchen ein Mischwesen aus drei Tieren.
In religiösen Vorstellungen ist das Auftreten solcher Mischwesen nicht ungewöhnlich: Sie treten in verschiedenen Religionen unterschiedlichster Epochen immer wieder auf, besonders während eines Epochenwechsels mit einem damit verbundenen Wandel der religiösen Vorstellungen. Somit überrascht es kaum, dass die Urnenfelderkultur Elemente der Bronzezeit wie auch Elemente der Eisenzeit vereint. Welche exakte religiöse Bedeutung Wasservogel, Stier und möglicherweise Fisch für die Pfahlbauern hatte, ist heute leider nicht mehr nachvollziehbar. Vergleiche mit bekannten Naturreligionen können jedoch Möglichkeiten der Interpretation aufzeigen. So verkörpert der Wasservogel häufig das Element Wasser. Dieses gilt wiederum oft als mystischer Ort an dem sich der Lebenskreis schließt. Insbesondere für eine Bevölkerung, die direkt am Wasser gesiedelt hat, muss dieses Element von sehr großer Bedeutung gewesen sein. Vielleicht wurde, um dies zu betonen, noch der Fisch als weiteres Wasserlebewesen integriert. Der Stier versinnbildlicht dagegen sehr oft Stärke und Fruchtbarkeit. Gerade bei der Viehzucht hatte dieses Tier eine entscheidende Rolle im Leben der Menschen. Mit dieser Vereinigung könnte ein religiöser Gehalt dieser kleinen Figur betont worden sein. Wir wissen nicht, ob für die Anwohner am Bodensee von vor über 2800 Jahren der Wasservogel tatsächlich für Wasser als Kreislauf des Lebens stand. Dennoch ist es in gewisser Weise ergreifend, dass das kleine Bronzefigürchen von Hagnau bis vor ca. 100 Jahren in seinem Element lag und uns heute so viel Spekulationsraum über die Vorstellungswelt einer längst vergangenen Kultur liefert.
Text: Felicia Stahl, Institut für Ur- und Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Rosgartenmuseum, Konstanz/Pfahlbaumuseum Unteruhldingen
Foto: PM/Schöbel
Heiligenberg
Der Altheiligenberg – seit jeher ein besonderer Ort
Forscher entdeckten kulturelle Kostbarkeiten
Vielen mag der Altheiligenberg bisher nur als mittelalterliche Burgstelle ein Begriff gewesen sein, jedoch zeigen archäologische Funde an, dass bereits ab der Jungsteinzeit Siedlungsaktivitäten zu verzeichnen sind und auch in der Mittel- und Spätbronzezeit Spuren hinterlassen wurden, die auf eine Besiedlung des Bergs in diesen Epochen hindeuten.
Insbesondere keramische Scherbenfunde können als ein Nachweis einer weiteren mittelbronzezeitlichen Höhensiedlung im Bodenseeraum gewertet werden.
Außerdem ist eine eiserne Tüllenpfeilspitze der typologischen Einordnung HaD/LtA eine Hinterlassenschaft von eisenzeitlichen Menschen, die den Altheiligenberg aufsuchten.
Möglicherweise besaß der bewohnte Altheiligenberg als ein Knotenpunkt in einem Netz des Austauschs besondere Bedeutung für die prähistorischen Menschen aus dem Bodenseekreis.
Mittelbronzezeitliche Höhensiedlungen auf den Kuppen des Bodenseebeckens standen mit großer Wahrscheinlichkeit in einem engen Kontakt zu den prähistorischen Pfahlbauten am Bodensee.
Funde aus der Bronzezeit, die u. a. aus der Böschung eines Forstweges auf dem Altheiligenberg geborgen werden konnten, sowie jungsteinzeitliche Scherben finden sich bereits in Ernst Wagners „Fundstätten und Funde im Großherzogtum Baden - Teil I” von 1908 erwähnt: Eine dunkle Erdschicht, die in der Zeit entstanden ist, als die Keramik zu Bruch ging (eine sogenannte „Kulturschicht”), habe Tierknochen und Gussklumpen geführt. Immer wieder war es auf dem Altheiligenberg möglich Hinterlassenschaften prähistorischer Menschen zu finden. So zum Beispiel 1989, als oberhalb des Forstwegs bronzezeitliche Scherben gefunden wurden. Auch 1997 traten Funde zu Tage, die von Mitgliedern des Heimatvereins Heiligenberg gemacht wurden.
Es wurde ersichtlich, dass bei der Beschäftigung mit der Fundstelle Altheiligenberg verschiedene Stellen auf dem Plateau und somit auch verschiedene Phasen der Besiedlungsgeschichte eine eingehendere Untersuchung verdienen.
Freilich ist der Altheiligenberg nicht unbedingt eine hinsichtlich der Nord-Süd-Kommunikationsroute verkehrsgeografisch günstig gelegene Örtlichkeit, da die Fundstelle am Steilabfall des Oberschwäbischen Hügellandes liegt. Der Berg liegt jedoch beherrschend über dem Salemer Becken. Demnach lag auf dem Altheiligenberg nicht einfach nur zufällig eine kleine Siedlung zäher Bronzezeit-Menschen (deren keramische Gefäße hin und wieder zu Bruch gingen). Die Höhensiedlung hatte eine Bedeutung, die sie ihrer Lage verdankte!
Dass die eine oder andere Scherbe in die Erde gelangt ist und die Zeit überdauerte, ist wenig überraschend, da zwar Keramik sehr zerbrechlich ist, sich aber der Scherben alleine im Vergleich mit anderen Materialien als recht widerstandsfähig erweist.
Oftmals bilden Scherbenfunde die Basis für Aussagen, die die Archäologin oder der Archäologe über ihren Fundplatz in Bezug auf das Alter oder Aspekte des Siedlungswesens trifft.
Neben den beispielsweise sehr schönen Scherbenfunden leistenverzierter Gefäße wurde auf dem Sporn auch die Scherbe eines mit einer sogenannten Kerbleiste versehenen Henkelgefäßes aus der mittleren Bronzezeit gefunden. Spätbronzezeitliche Scherben weisen darauf hin, dass die Besiedlung des Geländes über einen längeren Zeitraum bestanden haben könnte. Ein weiterer Scherbenfund ist möglicherweise einem jüngeren Horizont, der sogenannten Zeitstufe HaD1-LtA, zuzuordnen und deshalb der frühen Latènezeit, einer Blütezeit der Kelten.
Der Altheiligenberg ist ohne Zweifel ein ganz besonderer Ort.
Text: Elena Reus, Institut für Ur- und Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Wilhelm Hübschle, Heiligenberg
Immenstaad
Schützendes Amulett oder einfaches Schmuckstück?
Zwei spätbronzezeitliche Anhänger vom Kippenhorn
Die Pfahlfelder am Kippenhorn bei Immenstaad wurden 1888 erstmals in einem Bericht von J. Heierli erwähnt. Das Fundspektrum aus unterschiedlichen Perioden der Jungsteinzeit und der späten Bronzezeit deutet verschiedene Siedlungen in der Uferzone am Kippenhorn und östlich davon an. Die archäologischen Objekte werden in verschiedenen Sammlungen rund um den Bodensee, so zum Beispiel in den Museen von Konstanz und Friedrichshafen, aufbewahrt. Die beiden hier gezeigten, etwa 3000 Jahre alten Anhänger, die 1895 geborgen wurden und für gewöhnlich in der Dauerausstellung des Städtischen Museums Überlingen zu sehen sind, gehören zu den auffälligsten Zeugnissen der Pfahlbauten von Immenstaad.
Die Schmuckstücke aus Bronze, ein Rad- und ein Dreiecksanhänger, stammen aus der sogenannten Urnenfelderzeit und sind in der Spätbronzezeit Mitteleuropas durchaus verbreitet. So ist beispielsweise eine gewisse Konzentration von Radanhängern dieser Form in der Region München festzustellen und findet auch Parallelen donauabwärts in Osteuropa, während die Dreiecksanhänger mit sehr ähnlichen Formen in der Westschweiz verwandt sein dürften.
Diese Art von Schmuckstück taucht zunächst vor allem als Beigabe in Gräbern von Frauen auf. Später sind Anhänger vermehrt in Hortfunden, das heißt Niederlegungen von mehreren Gegenständen, vermutlich als Opfergabe oder Warenverstecke von Händlern vorzufinden.
Das erste der beiden Stücke weist das Aussehen eines Rades mit einfachem Speichenkreuz auf. Darüber hinaus sind auch noch andere Formen von Radanhängern mit einer größeren Zahl von Speichen bekannt. Diese Gestaltungsart ist bereits in früheren Phasen der Bronzezeit üblich und dürfte mehrere Jahrhunderte gebräuchlich gewesen sein. So stammt ein sehr ähnlicher Fund beispielsweise aus einem Grab bei Aying (Lkr. München), das vermutlich in die Mitte des zweiten Jahrtausend v. Chr. datieren dürfte, während ein anderer einfacher Speichenradanhänger aus einem Grab in Grünwald (ebenfalls Lkr. München) wohl über 200 Jahre jünger ist. Schmuckstücke diesen Types treten mit oder ohne Öse auf und wurden in der Regel in einer einschaligen Form gegossen. Funde aus einigen Gräbern deuten an, dass häufig mehrere Anhänger gleichzeitig im Bauch- oder Brustbereich getragen worden sind. Radanhänger und vergleichbare radförmige Objekte, wie zum Beispiel die Radnadeln aus der mitteleuropäischen Hügelgräberbronzezeit, welche der Urnenfelderzeit unmittelbar voran geht, werden von der Forschung immer wieder mit Sonnensymbolik und religiöser Bedeutung, wie zum Beispiel der Darstellung eines Sonnengottes, in Verbindung gebracht.
Bei dem zweiten Stück handelt es sich um einen Dreiecksanhänger oder „Klapperblech”, das wohl mit anderen seiner Art zu einem Collier verbunden war und beim Tragen ein schellendes Geräusch gemacht hat. Sie werden gelegentlich als vereinfachte Darstellungen eines menschlichen Rumpfes mit Kopf interpretiert. Dies hängt mit der Ähnlichkeit zu so genannten Schwalbenschwanzanhängern zusammen, deren „Rumpf” am unteren Ende in zwei länglichen Fortsätzen endet, die in dieser Interpretation als Beine angesehen werden.
Es ist gut vorstellbar, dass beide Stücke für die damaligen Menschen eine tiefergehende Bedeutung hatten und nicht bloß einfacher Schmuck waren. Möglicherweise wurden sie als Talisman, Glücksbringer oder schützendes Amulett angesehen, hatten religiöse Bedeutung oder waren wichtiger Bestandteil von Ritualen und Zeremonien. Vielleicht waren es aber auch einfach Schmuckstücke, die den Modegeschmack der damaligen Zeit getroffen haben.
Text: Felix Jürgens, Institut für Ur- und Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Museum der Stadt Überlingen
Foto: PM/Schellinger
Kressbronn
Der Kressbronner Krieger
3300 Jahre altes Grab mit wertvollen Beigaben aus ganz Europa
Ein überraschender Fund
Im Juni 1963 hoben Arbeiter im Hof des heutigen Hotel-Restaurants Zur Kapelle mit einem Bagger Schächte aus, als sie plötzlich etwas im Boden glänzen sahen: Es war die Spitze eines Bronzeschwertes! Als die Arbeiter weitergruben, tauchten noch weitere Gegenstände auf: eine Lanze, ein Dolch, zwei Nadeln und ein Bronzestab.
Das Amt für Denkmalpflege Tübingen wurde daraufhin sofort eingeschaltet und stellte bei einer archäologischen Nachgrabung fest, dass es sich um ein viereckiges sogenanntes Steinkistenflachgrab aus der späten Bronzezeit handelte. Die Archäologen der Denkmalpflege fanden noch weitere Beigaben wie Scherben von zwei Keramikgefäßen, einen Meißel, Zierknöpfe, Tierknochen, ebenso wie zahlreiche Nägel und Nieten. Diese haben vermutlich zu einer Dolch- und Schwertscheide sowie zu einem Schild gehört. Die hier gezeigte Lanzenspitze ist für die späte Bronzezeit ungewöhnlich schmal und elegant. Sie steckte wahrscheinlich auf einem Holzstab, der sich nicht im Boden erhalten hat.
Bestattungen in der Bronzezeit
Für die Bronzezeit (2200 – 800 v. Chr.) sind in Europa verschiedene archäologische Kulturgruppen fassbar. Da es keine Schriftquellen gibt, die diesen Gruppen einen Namen geben, werden sie von der modernen Forschung nach Art ihrer Keramik, ihrer Bestattungsweise oder nach dem ersten Fundort betitelt. Für die Gruppen der späten Bronzezeit gibt es den archäologisch-modernen Begriff „Urnenfelderkultur”, weil sie die Asche ihrer Toten in Urnen beisetzten. Der hier Beerdigte wurde auch verbrannt. Seine Asche wurde aber nicht in eine Urne, sondern über das ganze Grab hinweg flächig verstreut. Das macht das Kressbronner Grab für die späte Bronzezeit so besonders.
Wohlhabend in den Tod
Die reichen Grabbeigaben – besonders die Kombination von Schwert, Dolch und Lanze – sind ein Indiz für die hierarchisch hohe Stellung des Toten. Vielleicht war er sogar das Dorfoberhaupt.
Die wertvollen Beigaben zeigen neben Einflüssen aus anderen Regionen Deutschlands europaweite Kontakte der Bodensee-Anwohner zum heutigen Frankreich, Italien oder Tschechien. Nur ein Angehöriger der Oberschicht wurde so aufwendig bestattet.
Vielleicht handelte es sich bei dem Kressbronner Grab sogar um eine Doppelbestattung des Oberhauptes und seiner Frau. Denn es gibt „weibliche Beigaben” wie Nadeln und Knöpfe und „männliche Beigaben” wie Waffen. Ob im Grab die Asche von zwei Personen war, ließ sich jedoch wegen der teilweisen Zerstörung des Grabes nicht mehr feststellen.
Text: Maria Lill, Institut für Ur- und Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Landesmuseum Württemberg, Stuttgart
Foto: Alex Hochdorfer, Landesmuseum Württemberg, Stuttgart
Langenargen
Die Argen als Opferplatz?
Ein Bronzeschwert aus der Mündungsstelle der Argen wirft Fragen auf
Funde aus Gräbern oder aus Gewässern belegen, dass Wasser neben Feuer in der Vergangenheit ohne Zweifel zu den am religiös am stärksten verehrten Elementen gehört. Sie ermöglichen uns Einblicke in die Religion und den Kult ehemaliger Bevölkerungen.
Einen solchen Gewässerfund stellt auch das Bronzeschwert aus Langenargen, Kreis Tettnang in Baden-Württemberg dar. Dieses wurde am 1951 bei einer Regulierung im Mündungsbereich der Argen, etwa 1,5 km südöstlich von Langenargen, entdeckt. Es handelt sich hierbei um ein spätbronzezeitliches Griffzungenschwert der älteren/mittleren Urnenfelderzeit und datiert um 1200v. Chr.. Bei dem Exemplar aus Langenargen handelt es sich um ein symmetrisch aufgebautes, zweischneidiges Griffzungenschwert vom Typ Hemigkofen, Variante Elsenfeld. Dieser Schwerttyp ist in die chronologische Zeitstufe Ha A1/A2 einzuordnen. Es liegen keine Beifunde vor.
Auf eine Verlängerung der Klinge wird bei einem Griffzungenschwert dieses Typus das Griffstück aufgesetzt. Klinge und Griff sind bei dem Schwert aus Langenargen durch sieben Nieten verbunden, wobei fünf davon als Pflocknieten angesprochen werden und die anderen zwei Nieten sich im Bereich des schmal-trapezförmigen Hefts befinden. Die Nieten dienten der Befestigung einer Ummantelung aus Holz, Geweih oder Leder. Sowohl die Nieten, als auch die Schwertscheide und die Griffschalen haben sich nicht erhalten. Ebenso kennzeichnend sind unter anderem die nahezu parallelseitige Griffzunge sowie hörnerartig auslaufende Stegen. Die Schultern des Schwerts werden als gerade, straff nach unten gestreckt beschrieben. Fast rechtwinklig zu den Schultern verläuft auf der Klinge eine lange, scheinbar gekerbte Erhöhung, welche keine Schärfe aufweist. Im letzten Drittel der Klinge zeigt sich eine Ausbauchung.
Das Bronzeschwert weist eine Länge von 51,7 cm auf. Im überlieferten Zustand beträgt die Heftbreite 4,3 cm und die Zungenbreite 2,6 cm. Unterhalb des Griffs weist die Schwertschneide eine gezahnte Verengung auf. Dieser 4,7 cm lange Abschnitt wird als Ricasso bezeichnet. Zum Schutz des Daumens wurde hier vermutlich eine Umwickelung angebracht. Die Schwertklinge liegt in leicht verbogenem Zustand vor. Im Bereich des gesamten Bodensees finden sich zahlreiche Schwerter mit ähnlichem Erscheinungsbild und vergleichbarer Datierung. Vielfach wurden die Funde aus Gewässern oder Feuchtboden geborgen, aber auch beispielsweise aus Siedlungen oder Gräbern. Durch die Lagerung im Wasser bildete sich auf der Oberfläche des Schwerts aus Langenargen eine altgoldene bis kupferfarbene Wasserpatina. Auf Grund der Fundsituation im Gewässer, fern von einer Siedlung, handelt es sich um einen Gewässer-/Feuchtbodenfund. In der Nähe wurden zwar verschiedene Siedlungs- und Grabfunde aufgedeckt, ein direkter Bezug zu dem Bronzeschwert aus Langenargen kann jedoch nicht festgestellt werden.
Die Neigung zum Wasser zeigt sich sehr deutlich nicht nur im Bereich des Bodensees, sondern in ganz Deutschland und darüber hinaus. Besonders in Süddeutschland finden sich dutzende vergleichbare Griffzungenschwerter der Urnenfelderkultur. Oftmals werden diese als Weihefunde interpretiert. Es handelt sich dabei um eine vorwiegend bronzezeitliche Erscheinung, bei welcher Sachgüter als eine Art Opfergabe fungieren und an einem heiligen Ort deponiert werden. Demnach wäre der Schwertfund aus Langenargen bewusst im Wasser platziert, genauer gesagt geopfert worden. Eine Deponierung aus nicht religiösen Gründen oder gar eine Verlustsituation wären ebenso möglich. Für einen Opferfund lässt sich beispielsweise die leichten Biegung der Klinge als Argument anführen.
Unklar ist, ob es sich hierbei um ein gezieltes Zerstören oder Beschädigen des Gegenstandes handelt. Bei einem rituellen Vorgang könnte die Klinge des Schwertes bewusst verbogen und als eine Art Opfergegenstand ins Wasser niederlegt worden sein. Vergleichsfunde zeigen, dass in Form einer solchen Opferung der Gegenstand häufig verbogen wurde. Dem Betrachter bleibt hier viel Platz für Interpretationen. Wie der Fund tatsächlich in die Argen gelangte, ist jedoch bislang ungeklärt.
Text: Sonja Boschert, Institut für Ur- und Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Stadtarchiv Friedrichshafen
Foto: PM/Schellinger
Markdorf
Des Kaisers Münzen
Markdorf, kurz nachdem die Alamannen kamen
Am 24. Januar 1911 erreichte ein Brief den Leiter der Großherzoglichen Altertümersammlung in Karlsruhe, Ernst Wagner. Der Absender war Hermann Gropengießer, Museumsdirektor in Mannheim. Darin kündigte er an, Wagner eine Münze zukommen zu lassen. Sie stamme aus Markdorf am Bodensee, datiere in die römische Zeit, zeige ein Kaiserporträt auf der Vorder- und einen Altar auf der Rückseite. Die Münze war von einem Lehrling eines befreundeten Bankdirektors aus Mannheim gefunden worden. Eine weitere Markdorfer Bronzemünze des gleichen Kaisers mit unklarer Fundgeschichte wird ebenfalls ausgestellt.
Das sehr gut erhaltene Geldstück, ein sog. „follis”, wurde in Augusta Treverorum, dem heutigen Trier, in den Jahren 323/324 n. Chr. geprägt. Zu dieser Zeit herrschte Kaiser Flavius Valerius Constantinus (Konstantin der Große). Trier war zwischen dem späten 3. und dem ausgehenden 4. Jh. n. Chr. eine der westlichen Kaiserresidenzen. Konstantin erlangte ab 324 n. Chr. die Alleinherrschschaft im römischen Imperium. Unter anderem gründete er Konstantinopel/Istanbul und führte das Christentum als Staatsreligion ein.
„Follis” wurden um 294 n. Chr. im Rahmen der Währungsreformen unter Diokletian eingeführt. Sie haben einen Wert von 1/32 eines römischen Pfundes („Libra”), ca. 10 Gramm, wurden aus Bronze geprägt und mit einem dünnen Silberfilm überzogen. „Follis” bedeutet Beutel und geht vermutlich auf einen Ausdruck für eine versiegelte Börse zurück, die in der Antike eine festgelegte Anzahl von Münzen enthielt. Den antiken Namen der Münze kennen wir nicht, der Begriff „follis” entstand später. Münzkundler vermuten, dass der antike Name der Währung „nummus” lautete. Bei Einführung 294 n. Chr. hatte der „follis” einen Wert von 12,5 „denarii communes” (d. c. = Rechnungsdenare), bei der Währungsreform vom 1. September 301 n. Chr. wurde er auf 25 d. c. aufgewertet. Unter Konstantin I. wurden die „folles” neu bewertet, verkleinert und enthielten kein Silber mehr.
Markdorf liegt in einer Senke, durch die schon immer eine Verbindungsroute zwischen Friedrichshafen und Oberschwaben verlief. Hier darf ein Teil des gut ausgebauten römischen Straßennetzes vermutet werden. In der Zeit Konstantins war die römische Grenzbefestigung, der Limes, aufgrund der Bedrohung des Reiches durch germanische Stämme schon weit zurück genommen worden, in unserer Region bis an den Rhein. Der nördliche Bodenseeraum war somit nicht mehr unter direkter Kontrolle der Römer, die alamannischen Lentienses gründeten in diesem Bereich neue Siedlungen.
Allerdings endete der Handel und der Austausch zwischen Römern und Germanen nicht. Weiterhin waren die Handelsrouten quer durch Europa wichtig, oft entlang der alten Römerstraßen. Zeichen für diesen Handel sind die überall zu findenden römischen Münzen, die auch von den Germanen als Zahlungsmittel akzeptiert wurden.
Text: Redaktion Pfahlbaumuseum/Max Hermann, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Badisches Landesmuseum, Karlsruhe/ Rosgartenmuseum, Konstanz
Foto: PM/Schellinger
Meckenbeuren
Steinzeit zwischen Flughafen
und Ravensburger Spieleland
Ein spannender Fund aus dem Tettnanger Stadtarchiv
Zwischen Friedrichshafen und Ravensburg liegt Meckenbeuren (31,9 km², 13.000 Einwohner). Es ist heute mit der Stiftung Liebenau und einigen Unternehmen wirtschaftlich sehr erfolgreich.
Der Flusslauf der Schussen prägt das Gemeindegebiet. Das eiszeitliche Hügelland liegt hier weit vom Seeufer entfernt, eine gestufte, beim Rückzug des Rheingletschers durch Stauseen und Schmelzwasserrinnen entstandene Terrassenlandschaft prägt die Landschaft.
Am 10. September 1937 schreibt der Bürgermeister von Meckenbeuren an Dr. Veeck, den Leiter der Altertümersammlungen in Stuttgart: „... teile ich Ihnen mit, dass in der Gemeinde Meckenbeuren solche [prähistorischen und historischen] Funde oder Fundstellen nicht vorhanden sind.” ... Bis heute hat sich daran nur wenig geändert.
Die ältesten bekannten Funde sind eine bei Reute gefundene Steinaxt (4800–4400 v. Chr.) und ein Steinbeil Beil aus Siglishofen (3850–3400 v. Chr.). Es wurde nach dem 2. Weltkrieg von Herrn Weishaupt aus Reute auf der unteren Tettnanger Terasse, südöstlich von Kehlen-Siglishofen in geringer Entfernung zur Schussen gefunden. Wir wissen nicht, ob es weitere zugehörige Funde gibt. Das Beil ist trapezförmig, 15 cm lang, 5 cm breit und 2 cm dick. Es besteht aus Amphibolit, einem in der Jungsteinzeit gerne verwendeten metamorphen Gestein. Wie kam es an den Fundort? Die Schussen verbindet den Bodensee mit dem Federsee, beide Regionen waren ab der Jungsteinzeit intensiv besiedelte Gebiete. Die Fortbewegung gestaltete sich vor 6000 Jahren im dichten Wald schwierig, Flusstäler waren die wichtigsten Verkehrsachsen. Dementsprechend finden sich Hinweise vorgeschichtlicher Landschaftsnutzung insbesondere an Flüssen und Bächen. Das Beil kann bei einer Handelsreise, bei Arbeiten zur Beschaffung von Bauholz oder bei der Öffnung des Waldes für Wege verloren worden sein. Es wird am wahrscheinlichsten von Siedlern der Pfahlbauten westlich von Friedrichshafen am Fundort benutzt worden sein. Viele der einzeln gefundenen Steinbeile weisen wie das Exemplar aus Siglishofen kaum Benutzungsspuren auf. Das könnte auch ein Hinweis auf eine absichtliche Niederlegung im Rahmen kultischer Handlungen sein.
Verschollen ist ein bronzezeitlicher Hortfund (7 Beile) aus Liebenau. Eines war lange Zeit in der Sammlung der Freiherren v. Koenig-Warthausen erhalten, ab den späten 1970er Jahren verliert sich diese Spur in die Vergangenheit.
Die Eisen- und Römerzeit, sowie das Frühmittelalter konnten auf dem Gemeindegebiet noch nicht nachgewiesen werden. 13 Fundstellen oder Baudenkmale in der Denkmalliste datieren mittelalterlich.
879 wird in einem Dokument des Klosters St. Gallen der Siedler Megi im Raum des heutigen Meckenbeuren erwähnt. Ab 1094 gehörte das Gebiet zum Kloster Weingarten. In einer von Papst Nikolaus III ausgestellten Urkunde vom 4. August 1278 wird Meckenburron genannt. Sie war von Hermann von Bichtenweiler, Abt des Klosters Weingarten in Rom erbeten worden, um die Besitzungen des Klosters abzusichern (Urkunde im Hauptstaatsarchiv Stuttgart). 1530 ging das Dorf an Graf Haug von Montfort, 1780 an Österreich, 1806 an Bayern, 1810 an Württemberg. Der Anschluss der Gemeinde an die Bahnlinie Stuttgart-Friedrichshafen brachte 1847 wirtschaftlichen Aufschwung, die Bahnstrecke Meckenbeuren-Tettnang war 1895 die erste elektrisch betriebene Vollbahn Deutschlands.
Text: Peter Walter, Pfahlbaumuseum Unteruhldingen
Leihgeber: Stadtarchiv Tettnang
Foto: PM/Schellinger
Meersburg
Feuer ohne Feuerzeug
Wozu man Feuer in der Jungsteinzeit nutzte
In Meersburg-Haltnau findet sich mit einigen Gebäuden nicht nur eine reichhaltige mittelalterliche Geschichte. Das in der Flachwasserzone liegende ca. 2 ha große Pfahlfeld weist auf eine vorherige bronzezeitliche Ansiedlung hin. Ein an der Oberfläche entdeckter Lesefund – ein Geweihstück mit Bohrgruben – stammt aus noch fernerer Vergangenheit. Bekannt sind solche Stücke aus der späten Jungsteinzeit, in der die ersten sesshaften Bewohner der Pfahlbauten lebten. Verwendet wurden sie als Widerlager beim Bohren oder beim Feuer machen. Beim sogenannten Feuerbohren wird ein Holzstab senkrecht in eine weichere Holzunterlage gebohrt und mit einer Bogen-Schnur-Konstruktion schnell bewegt. Es entsteht feiner glühender Holzstaub, mit dem mit etwas Geschick ein Feuer entfacht werden kann. Doch was genau ist an Feuer so wichtig?
Feuer ist schon lange als Wärme- und Lichtquelle sowie zum Schutz vor Tieren bekannt. Nicht nur vor großen Raubtieren schützt es, auch kleine Tiere, wie Insekten wie Stechmücken und Flöhe mögen Feuer und Rauch nicht.
Zudem verändern Feuer und Hitze die Eigenschaften mancher Materialien. So wird aus Ton durch die hohen Temperaturen härtere und somit dauerhaftere Keramik. Aus der Jungsteinzeit sind uns zahlreiche Beispiele verschiedener Gefäße und Alltagsgegenstände wie Töpfe, Flaschen und Spinnwirtel aus Keramik bekannt.
Eine sehr wichtige Anwendung für das Feuer liegt in der Ernährung. Durch das Kochen und Braten von Nahrungsmitteln werden Aromastoffe frei gesetzt, der Geschmack verändert sich. Harte Lebensmittel wie z.B. eingelagertes, getrocknetes Getreide werden weicher und leichter verdaulich. Eiweiße und Kohlenhydrate werden abgebaut, sodass der Körper die in den Lebensmitteln enthaltenen Nährstoffe besser aufnehmen kann.
Außerdem werden durch das Erhitzen Gifte zerstört. Ein Beispiel dafür ist das heutzutage aus anderem Kontext bekannte „Wurstgift” Botox. Im intakten Zustand reichen davon schon sehr geringe Mengen, um einen Erwachsenen zu töten. Ein anderes Beispiel ist das Pflanzengift Phasin, das in Hülsenfrüchten enthalten ist, die ab dem Aufkommen des Ackerbaus eine wichtige Eiweißquelle der menschlichen Ernährung waren. Neben Giften werden auch Pilze und Bakterien abgetötet, die Gärungen einleiten. Lebensmittel werden auf diese Weise haltbar gemacht. Ohne Feuer gibt es auch keinen Rauch und somit kein Räuchern. Setzt man Lebensmittel lange genug dem Rauch aus, wird ihnen Feuchtigkeit entzogen und es lagern sich Verbindungen an, die erneutes Bakterienwachstum unterbinden. Geräucherte Lebensmittel werden dadurch sehr lange haltbar.
So war Feuer ein wichtiger Bestandteil des Lebens in den Pfahlbauten, hat aber auch bei Unachtsamkeit für so manche Pfahlbausiedlung das Ende bedeutet. Verkohltes Holz und andere organische Materialien erhalten sich jedoch unter Sauerstoffabschluss noch besser als unverkohlte – ein Glück für die Archäologen heute. Auch ist Holzkohle ein geeignetes Farbpigment und hat in der Medizin, etwa bei Verdauungsproblemen, Einsatzbereiche.
Text: Redaktion Pfahlbaumuseum/Anna Loy, Institut für Ur- und Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Michael Fiebelmann, Überlingen
Foto: PM/Schellinger
Neukirch
Wallfahrtsziele der Neukirchener in der Frühen Neuzeit
Ausgrabungen in der alten Kirche Sankt Silvester liefert neue Erkenntnisse
Die ausgestellten Medaillons sind Andenken, die Bürger aus Neukirch von ihren Wallfahrten mitbrachten. Sie stammen überwiegend aus dem 18. Jahrhundert und sind größtenteils aus Kupfer gefertigt. Die Anhänger wurden vor allem an Rosenkränzen befestigt, konnten aber auch um den Hals an einer Kette getragen werden. Sie zeigen die Ziele der Wallfahrten und wer dort verehrt wurde, z.B. Maria, Christus, Heilige oder Reliquien. Nachweislich am weitesten entfernt liegt Maria Trost, heute ein Stadtteil von Graz (Steiermark/Österreich). Doch die meisten Ziele sind wie Altötting und Scheyern (beide in Bayern) 200 bis 300km entfernt.
Insgesamt wurden 164 religiöse Anhänger bei der Ausgrabung in der alten Kirche Sankt Silvester in Neukirch gefunden. Es handelt sich damit um den mit Abstand größten Fundkomplex in Baden-Württemberg. Die Medaillons gingen beim Gebrauch der Rosenkränze verloren und fielen vermutlich durch die Ritzen im Holzboden der Kirche. Neben den hier dargestellten Wallfahrtsandenken waren auch Kreuzanhänger und Heiligenmedaillen sowie Abzeichen religiöser Bruderschaften vertreten. Zusammen mit den Anhängern wurde auch eine große Anzahl von Rosenkranzperlen gefunden. Die Funde aus Neukirch stellen eine wichtige Quelle zur Erforschung barocker Frömmigkeit in Südwestdeutschland dar.
Ausgrabung in S. Silvester liefert Informationen zur Bau- und Ortsgeschichte
Als 1979 das Schiff der alten Kirche Sankt Silvester in Neukirch abgerissen wurde, führte die Außenstelle Tübingen des Landesdenkmalamts Baden-Württemberg eine Grabung durch. Zwei Gräber aus dem frühen Mittelalter stellen die ältesten Befunde dar. Diese beweisen die Existenz der Siedlung noch vor dem ersten urkundlichen Beleg. Erst 1122 ist „Neukirch” nachweisbar, doch könnte der Ort früher „Schönenberg” geheißen haben. Dieser Ortsname wird bereits 837 in Schriftquellen genannt.
Von Sankt Silvester zu Sankt Maria Rosenkranzkönigin
Im 10./11. Jahrhundert entstand eine kleine Saalkirche mit steinernem Fundament. Sie wurde durch eine größere romanische Kirche mit Chor abgelöst. Dieser Kirchenbau lieferte vielleicht den Anlass zur Benennung des Orte„Neukirch‘.rch”. Der noch heute erhaltene Turm stammt ebenfalls aus dieser Zeit. Der Rest der Kirche wurde im Spätmittelalter abgetragen und durch einen gotischen Neubau ersetzt. 1750 wurde die Kirche nach Westen erweitert und grundlegend renoviert. Dabei wurde der Innenraum im Stile des Barock überarbeitet. 1979 wurde die Kirche bis auf den Turm und den Chor abgerissen und durch ein neues, größeres Gebäude ersetzt. Seitdem ist sie Sankt Maria Rosenkranzkönigin geweiht.
Text: Doris Schuller, Institut für Ur- und Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg, Ref. 84.2, Tübingen
Foto: PM/Schellinger
Oberteuringen
Frühkeltische Gräber im „Schlattholz”
Vermittler zwischen Ost und West?
Im Wäldchen Schlattholz reihen sich bis zu 20 Grabhügel in einer Linie aneinander. Manche Hügel stehen sich näher, andere weniger, was möglicherweise auf Familienbande zurückzuführen ist. Sie weisen heute noch Höhen von bis zu 2 m auf, in der Breite variieren sie zwischen 5 und 20 m. Diese Grabmonumente zählen zu einer der größten Nekropolen der vorrömischen Eisenzeit im nördlichen Bodenseehinterland. Zu den charakteristischen Funden gehören die bunt bemalten sowie ritz- und stempelverzierten Scherben mehrerer Gefäße aus einem 1901/02 durch Pfarrer Deufel und Schultheiß Hager untersuchten Grabhügel.
Die rot bemalte Grabkeramik mit Stempeldekor zeigt, dass die imposanten Grabmonumente aus der älteren Hallstattzeit (8./7. Jh. v. Chr.) stammen. Diese Keramik ist Bestandteil umfangreicher Speise- und Trinkservice, die dem Toten mit ins Grab gegeben wurden. Möglicherweise diente diese Keramik einem Totenmahl, so wie es Speise- und Getränkereste in anderen Gräbern dieser Zeit vermuten lassen. Überliefert ist diese eindrucksvolle und aufwendig verzierte Feinkeramik fast ausschließlich aus dem Grabkontext. In den Siedlungen hingegen wurden grobe Wirtschaftsgefäße benutzt, die im Alltag Verwendung fanden. Äußerst selten wurden den Menschen dieser Zeit persönliche Gegenstände mit ins Grab gegeben. Daher ist das Schwert aus einem der anderen Oberteuringer Hügel ein besonderer Fund. Schwerter sind nicht in allen Nekropolen der westlichen Hallstattkultur vertreten, weshalb sie den Träger als Person von gehobener Stellung ausweisen. Auch die imposanten Grabmonumente selbst deuten auf die Ansässigkeit einer gesellschaftlichen Elite hin. Der Tote wurde zumeist auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Davon zeugt auch die Brandplatte aus dem von Pfarrer Deufel untersuchten Grab, neben der die Gefäße niedergelegt waren. Der Leichenbrand wurde mitsamt den Beigaben in einer Holzkammer deponiert, über der im Anschluss der Erdhügel aufgeschüttet wurde.
Die Verzierung der Keramik, insbesondere die bunte Bemalung sowie geometrischer Ritz-und Stempelzier, weist die damalige Bevölkerung der Alb-Salem-Gruppe (heute Alb-Hegau-Gruppe) zu. Die Gräber und Siedlungen dieser weitläufigen Kulturgruppe verteilen sich bis hin an den Rhein und die Donau. Die südlichsten Fundstellen findet man im Hegau und der nördlichen Schweiz. Verzierungen wie Häkchen und Kreuzstempel an den Oberteuringer Gefäßen deuten darüber hinaus auf enge Kontakte zur Schwäbischen Alb, Oberschwaben und Bayern hin. Wenig westlich, z.B. aus dem Gräberfeld von Salem so wie im benachbarten Hegau, trifft man diese Verzierungen äußerst selten an. Daher stellt sich die Frage, ob die zum Oberteuringer Gräberfeld zugehörige Siedlung womöglich in einem Grenzgebiet verschiedener Kulturgruppen lag. Da bis heute nicht alle Hügel untersucht sind, lässt sich darauf noch keine Antwort finden. Die Siedlung selbst ist bisher unbekannt, man weiß aber, dass sich die kleinen Gehöfte und Weiler in unmittelbarer Nähe zu den Bestattungsplätzen befanden. Daher verwundert es kaum, dass die Nekropolen an alten Wegen und verkehrstopographisch günstigen Punkten zu finden sind. Weitere Nachforschungen könnten Aufschluss über die kulturelle Verortung der Oberteuringer Gräber sowie Handelsbeziehungen zwischen Hegau, Schwäbischer Alb und Bayern liefern, die bisher im Unklaren liegen.
Text: Jasmin Rauhaus, Institut für Ur- und Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Landesmuseum Württemberg, Stuttgart
© Alex Hochdorfer, Landesmuseum Württemberg, Stuttgart
Owingen
Kleine Krümel – große Geschichte
Tonscherben als Puzzlestück der Geschichte Billafingens und Umgebung
Einige Scherben aus beige-braunen Ton mit verwitterter, teilweise rot-schwarzer Oberfläche und groben mineralischen Einschlüssen (Magerung) – viel mehr ist nicht übrig geblieben von den ersten Bewohnern der Gemeinde.
Manchmal sind solche unscheinbare Funde die einzigen Zeugen für die Anwesenheit vorgeschichtlicher Menschen und deren Tätigkeiten. Sie stellen wichtige archäologische Puzzlestücke für die Forscher bei der Rekonstruktion der Vergangenheit dar. Wie und wo genau wurden sie gefunden? Gibt es vergleichbare oder zeitgleiche Funde in der Umgebung oder auch weltweit? Wie passen sie in die Geschichte der Region? Durch das Zusammensetzen aller Funde und ihrer Geschichten ergibt sich ein Gesamtbild der Vergangenheit. Die Gefäßreste aus Billafingen stehen am Anfang der Geschichte Owingens.
Landschaftlich gehört Billafingen zum eiszeitlich geprägtem Stockacher Bergland. Nacheiszeitliche Schmelzwasserrinnen bildeten das Billafinger Tal und das parallele Hochtal von Nesselwangen. Dazwischen zieht sich ein bewaldeter Bergrücken mit steilwandigen Tobeln und vorspringenden Höhenplateaus. Auf einer solchen Anhöhe wurden die Scherben gefunden. Heute noch beliebte Ausflugsziele, werden solche Geländesporne seit der Eiszeit immer wieder aufgesucht und besiedelt. Hier konnten die Menschen weit in die Ferne und hinab auf die Täler und Passwege schauen. So auch auf den Passweg, der heute Billafingen mit Nesselwangen verbindet. Früher war dieser einer der möglichen Handelswege zwischen Bodensee und Donau. Vergleichbar mit heutigen Zollstationen, konnte durch die Besetzung der Höhenlagen der Handel einer ganzen Region kontrolliert werden. An drei Seiten durch steile Hänge geschützt, ist der Bergsporn zudem ein idealer Fluchtort bei Gefahr. An der vierten Seite schütteten die Menschen Wälle auf und huben Gräben aus. Auf diese Weise befestigte und leicht zu verteidigende Geländesporne wie den am Eisbrunnen gibt es viele in Billafingen und Umgebung. Oftmals lassen sich Überreste der schützenden Wälle und Gräben noch heute in der Landschaft entdecken. Neben Fluchtort und vorgeschichtlicher „Zollkontrolle” trieb es die Menschen im Laufe der Zeit auch aus anderen Gründen auf die Anhöhen: z.B. als kurzer Rastplatz, möglicher Ort für Versammlungen oder religiöse Zeremonien. Auch als Standort längerfristiger Lager, Siedlungen und weit sichtbarer Burgen der Mächtigen im Mittelalter wurden die Höhenlagen geschätzt.
Die ausgestellten Scherben datieren auf ein Alter von ca. 5500-3000 Jahren. Ein Beweis dafür, dass bereits damals Menschen von dort hinab in das Billafinger Tal blickten. Haben sie den fremden Händler beobachtet oder ängstlich nach Feinden Ausschau gehalten? An der Fundstelle lassen sich heute noch Reste von zwei Schutzwällen entdecken. Legten die Besitzer der Keramikgefäße diese an? Oder wurden sie erst später von den Erbauern der Grabhügel errichtet, die sich in unmittelbarer Nähe befinden? Intensivere archäologische Untersuchungen könnten diese Fragen beantworten.
Der heutige Siedlungsort Billafingen befindet sich im Gegensatz zu der Fundstelle in einer Talsenke. Er ist eine Gründung der Alamannen, wie seine Endung auf – ingen verrät. Seine erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 970 n. Chr. Die Zwingenburg, Kaplinz und Hohenbodman sind wiederum Beispiele für die Nutzung der Anhöhen für den mittelalterlichen Burgenbau in der Umgebung.
Text: Vera Edelstein, Pfahlbaumuseum Unteruhldingen
Leihgeber: Uwe Frank, Gaienhofen
© PM/Schellinger
Salem
Ein Fundort macht Geschichte
Frühkeltische Gräber im Salemer Hardtwald
als Spiegel von Tradition und Wandel
Nordöstlich der heutigen Gemeinde Salem befinden sich im Hardtwald 19 Grabhügel im flachwelligen Waldgelände, welche die frühkeltische Besiedlung des Linzgaus während der Hallstattzeit (ca. 850–450 v. Chr.) wiederspiegeln. Durchmesser von bis zu 26 m und Höhen bis zu 3 m lassen diese imposant erscheinen. Frühe Grabungsaktivitäten, bei denen die Hügelmitte ausgehoben und die Erde nach außen aufgeworfen wurde, spiegeln sich auch heute noch in kraterartigen Vertiefungen wieder. Dank der sorgfältigen Ausgrabungen im Auftrag der markgräflichen Familie zählte dieses Gräberfeld Ende des 19. Jh. zu den berühmtesten in Süddeutschland. Insbesondere der Grabungsmethodik, die für die damalige Zeit auf dem modernsten Stand war, ist es zu verdanken, dass diese Gräber auch heute noch einen Einblick in die Hallstattzeit ermöglichen. Die reich verzierte und bunt bemalte Keramik aus den Salemer Gräbern wurde namengebend für die Alb-Salem-Gruppe (heute Alb-Hegau-Gruppe), die vom nördlichen Bodenseeraum, auf der Schwäbischen Alb und vom Hegau bis in die nördliche Schweiz ansässig war. Im Hinterland des nördlichen Bodenseeraums finden sich jedoch noch zahlreiche unerforschte Grabhügelgruppen, die womöglich in engem Kontakt mit der Salemer Fundstelle standen. Bei genauerer Betrachtung lässt sich der Verzierungsstil dieser Keramik von den benachbarten Regionen in Oberschwaben und im östlichen Bodenseeraum (z.B. Oberteuringen, Tannheim a. d. Iller) abgrenzen. Daher wäre es denkbar, dass im Salemer Raum eine kleinere, eng vernetzte Kulturgruppe ansässig war.
Aus den Gräbern der älteren Hallstattzeit (8./7. Jh. v. Chr.) stammen umfangreiche Trink- und Speiseservice, die eigens für den Verstorbenen hergestellt wurden. Diese dienten womöglich einem Totenmahl, zumindest deuten Speisen in den Gräbern darauf hin. Die größeren Gefäße weisen rote, schwarze und graue Bemalung auf. Die Muster sind zumeist in Stempel- und Ritztechnik entstanden. In dieser Zeit herrschte die Totenverbrennung auf dem Scheiterhaufen vor. Die Überreste wurden in Holzkammern niedergelegt und mit einem imposanten Erdhügel überschüttet. Persönliche Beigaben wie Schmuck, Waffen- oder Trachtelemente finden sich nur sehr selten.
Mit der jüngeren Hallstattzeit (6./5. Jh. v. Chr.) veränderte sich das Totenbrauchtum und damit wohl auch die Gesellschaft. Der Verstorbene wurde nun unverbrannt in den bereits bestehenden Hügeln bestattet. Persönliche Gegenstände, wie Schmuck oder Trachtelemente gelangten mit ins Grab. Diese Veränderungen verraten uns heute mehr über die Tracht, den Modegeschmack und manchmal auch über den Rang eines Einzelnen in der Salemer Gesellschaft. Zu den typischen Beigaben zählen bronzene Gewandspangen (Fibeln), die ähnlich wie Sicherheitsnadeln dem Verschließen der Kleider dienten. Da sich diese rasch mit der Mode wandelten, sind sie ein wertvoller Zeitmarker innerhalb der jüngeren Hallstattzeit. Zu den frühesten Fibeln zählen die Schlangenfibeln mit zwei Windungen und einer Schleife. Zwei solche Exemplare befanden sich an der Kleidung der zentralen Nachbestattung in einem Hügel, die auf dem Steinkranz des älteren Primärgrabs niedergelegt wurde.
Auch wenn die zum Gräberfeld zugehörige Siedlung bisher nicht bekannt ist, so sprechen prunkvolle Funde für die Ansässigkeit einer gehobenen Gesellschaft. Eiserne Schwerter, ein Prunkdolch und Bronzegeschirr, welche Parallelen zu den Fürstengrabhügeln Hohmichele, Magdalenenberg und Kappel am Rhein aufzeigen, sprechen für eine überregionale Vernetzung.
Text: Jasmin Rauhaus, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Badisches Landesmuseum, Karlsruhe
Foto: Badisches Landesmuseum, Karlsruhe/Hald
Sipplingen
Wie lebten die Menschen vor 5000 Jahren in Sipplingen?
Ein Messer aus der Jungsteinzeit gibt Antwort!
Antworten auf diese Frage geben die zahlreichen Funde aus den verschiedenen Phasen der Pfahlbausiedlungen.
Die Pfahlbausiedlung von Sipplingen-Osthafen wurden mit einigen Unterbrechungen in der Zeit zwischen 3919 und 934 v. Chr. besiedelt. Diese Zeit fällt in die Phasen der Jungsteinzeit und der Bronzezeit.
Die Jungsteinzeit (Neolithikum) ist das Zeitalter, in dem die Menschen das Leben als mobile Jäger und Sammler aufgaben. Sie wurden sesshaft, d.h. sie begannen in festen Siedlungen zu wohnen und dort Pflanzen und Getreide anzubauen sowie Tiere zu hüten.
Silexklinge aus der Jungsteinzeit
Die neolithische Silexklinge aus der Pfahlbausiedlung Sipplingen wurde vor einigen Jahren vom Hobbyarchäologen Herbert Gieß gefunden. Er fand das Schneidewerkzeug in einem Areal, dass von der Horgener Kultur besiedelte wurde. Die spätneolithischen Menschen der Horgener Kultur lebte zwischen etwa 3.400 bis 2.800 v. Chr. im südlichen Baden-Württemberg und Teilen der Schweiz.
Der Begriff Silex bezeichnet Feuerstein und andere Gesteinsarten. Das Material wurde bereits seit der Altsteinzeit von den Menschen zur Herstellung von Steingeräten verwendet. Aufgrund seiner Beständigkeit und Härte wird das Material auch als „Stahl der Steinzeit” bezeichnet. Durch Anwendung der richtigen Schlagtechnik und mit etwas Übung und Geschick stellten die Menschen Werkzeuge für die verschiedensten Tätigkeiten her.
Gegenüber den ersten Steinartefakten aus der Altsteinzeit hatten sich die Schlagtechniken und Geräteformen in der Jungsteinzeit soweit weiterentwickelt, dass die Geräte kleiner wurden.
Das Erstellen eines solchen Werkzeug umfasste mehrere Schritte: Als erstes benötigte man Rohmaterial, den unbearbeitete Feuerstein. Das Material stammte meist aus der näheren Umgebung, teilweise kam es aber auch aus weiterer Entfernung.
Im nächsten Schritt musste das Rohmaterial verarbeitet werden. Der unbearbeitete Stein wurde durch gezielte Schläge behauen. Vom Ausgangsstück (dem sog. Kern) wurden dadurch schmale Stücke abgebaut. Die entstandenen Klingen waren so scharf, dass sie ohne weitere Bearbeitung als Messer eingesetzt werden konnten.
Oft wurden die abgebauten Stücke auch noch überarbeitet um neben Klingen weitere Werkzeuge – wie Bohrer, Scharber oder Pfeilspitze – zu erhalten.
Im Feuchtboden hat sich unter Sauerstoffabschluss auch der Eschenholzgriff der Silexklinge erhalten. Man spricht bei diesem Fund von einem geschäfteten Werkzeug, d.h. dass die Klinge zur handlicheren Benutzung in einen Holzgriff eingesetzt wurde. Diese war vermutlich nötig, um sich bei der Nutzung nicht an den scharfen Kanten zu schneiden.
Aus Birkenrinde wurde Teer gewonnen und als natürlicher Klebstoff genutzt, um die Klinge im Holzgriff zu befestigen.
Dass viele der damaligen Steinwerkzeuge geschäftet waren, wird häufig vermutet. Gut erhaltene Funde wie dieser sind jedoch selten. Für Archäologen liefert der Fund daher wichtige Hinweise darauf, wie Werkzeuge tatsächlich ausgesehen haben.
Das Schneidewerkzeug könnte vielseitig eingesetzt worden sein, zum Zerlegen von Fleisch, Schneiden von Fasern oder Ernten von Pflanzen.
Die Lochung im Holzgriff spricht dafür, dass das Messer an einer Schnur, vielleicht um den Hals oder an einem Gürtel befestigt, getragen wurde.
Text: Hannah Arnold, Institut für Ur- und Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Herbert Gieß, Dingelsdorf
Stetten
Das untergegangene Dorf Oberstetten
Scherben erzählen Geschichte
Ein Acker auf halbem Weg zwischen Stetten und Riedetsweiler – keine Kirche, keine alten Bauernhäuser. Wer würde an dieser Stelle ein Dorf aus dem Mittelalter suchen? Und dennoch haben an dieser Stelle schon vor einem halben Jahrtausend Menschen gelebt. Die meisten Bewohner wissen davon heute freilich nichts mehr. Der Name dieses Dorfes war „Oberinstetin”. Vermutlich wurde es von „Alt-Stetten”, dem heutigen Stetten aus gegründet. Im Mittelalter war es üblich, Tochtersiedlungen anzulegen, wenn die Bevölkerung zu stark angewachsen war. Der Hauptgrund für die Gründung Oberstettens war wohl seine günstige Lage an der alten Landstraße direkt an der ehemaligen Handelsroute von Meersburg nach Ravensburg. Erstmals erscheint der Ort 1222 in Schriftquellen. In diesem Jahr erhält die Zisterzienserabtei Salem eine Schenkung aus der „villa qui dicitur Oberinstettin”, das bedeutet „aus dem Dorf, das Oberstetten heißt”. Der erste Oberstettener, von dem wir wissen, war Bruder Albert. Er wird 1254 als Laienbruder im Kloster Salem erwähnt (Cod. Dipl. Sal. 1,334). Für 1496 ist noch die Existenz eines Hauses belegt. Nach 1513 wird Oberstetten wie viele andere Orte in Deutschland völlig verlassen. Entweder weil das erhoffte Wachstums ausblieb oder aber weil viele Menschen an der Pest starben, die um 1610 im Bodenseeraum wütete. Neben Oberstetten gab es im Mittelalter um Stetten herum weitere kleine Ansiedlungen, die untergegangen sind: Das 1344 genannte Niederstetten und das 1222 erwähnte Kutzenhausen. Diese „wüst” gefallenen, aufgegebenen Orte nennt man „Wüstungen”.
Das einzige, was wir neben den schriftlichen Erwähnungen vom alten, „wüst” gefallenen Oberstetten heute noch haben, sind Funde. Sie sind das, was die Menschen als Abfall weggeworfen haben: Scherben zerbrochener Gefäße, Knochen geschlachteter Tiere, Glasfragmente und Metallstücke wie ein verlorenes Hufeisen. Sie geben uns Hinweise über das wahre Alter des untergegangenen Dorfes. Häufig erinnern auch noch Flurnamen, Baureste im Boden, mündliche Überlieferungen oder Sagen an die damaligen Orte. Manchmal werden Wüstungen zufällig etwa bei Bauarbeiten entdeckt, wenn sie von Wald oder Buschwerk überwachsen oder durch Erosion nicht mehr mit bloßem Auge zu erkennen sind. Gut kann man die verlassenen Ansiedlungen durch moderne naturwissenschaftliche Methoden aus der Luft erkennen. Das hängt damit zusammen, weil die Pflanzen dort, wo unterirdisch noch Mauerreste sind, weniger hoch wachsen, weil sie dort weniger Feuchtigkeit bekommen. Heutzutage beschäftigen sich Archäologen, Historiker und Geographen mit der Erforschung dieser untergegangenen Dörfer. Für sie stehen Fragen nach der Veränderung der Landschaft, aber auch Umweltrekonstruktionen im Mittelpunkt.
Erste Wüstungen bei uns gab es schon in vorgeschichtlicher Zeit, also schon vor 6000 und vor 3000 Jahren. Erst im Mittelalter begannen die Dörfer jedoch, an einem Platz zu bleiben und ihre Lage nicht mehr zu verändern. Der Grund dafür war die Einführung des Christentums. Mit dem Bau der ersten Kirchen entwickelten sich die Dörfer und Städte um die kirchlichen Zentren herum. Die Kirche wurde zum Mittelpunkt des Ortes. Der Ort wurde von nun ab nicht mehr verlegt, wie es in den Jahrtausenden zuvor immer der Fall war.
Text: Dr. Matthias Baumhauer, Pfahlbaumuseum Unteruhldingen
Leihgeber: Pfahlbaumuseum Unteruhldingen
Foto: PM/Schellinger
Tettnang
Das Keltengold aus Tettnang
Ein europäisches Zahlungsmittel der Antike
Diese keltische Geldstück aus dem 2./1. Jh. v. Chr. ist die Nachahmung einer griechischen Goldmünze und wurde Anfang des 20. Jh. n. Chr. bei Tettnang gefunden. Über die genauen Fundumstände wissen wir nichts Sicheres. In einer wissenschaftlichen Veröffentlichung von 2010 wird erwähnt, dass die Münze in einem Grab gefunden worden wäre.
Die schon aus der Argonautensage für ihren Goldreichtum bekannte Region Kolchis in Westgeorgien lag am Handelsweg von Griechenland in die Länder des Orients, Persien und Indien. Hier wurden zahlreiche griechische Münzen aus der Zeit Alexanders III. von Makedonien (Alexander der Große, 356-232 v. Chr.) entdeckt. Ab dem 2. Jh. v. Chr. fing man in der Kolchis damit an, selbst solche Münzen zu prägen und ahmte die griechischen Vorbilder nach (sog. kolchische Goldstatere). Diese Imitationen zeichnen sich durch stark stilisierte Münzbilder aus. Zur gleichen Zeit begannen auch die Kelten solche Münzen, die sie u. a. als Sold für Kriegsdienste in den Heeren der antiken Großmächte erhalten hatten, zu kopieren. So entstanden auch in Zentraleuropa zahlreiche typisch keltisch stilisierte Gold-, Silber- und Bronzemünzen, die hierzulande den Beginn der Geldwirtschaft markieren.
Im Bodenseeraum wurden bislang nur wenige keltische Münzen gefunden. Eine davon ist die vorliegende Goldmünze, die nach dem Vorbild makedonischer Tetradrachmen gestaltet ist. Sie wurde mit Eisenstempeln geprägt und weist einen gehämmerten hohen Rand auf. Ihr Durchmesser beträgt 17 mm, das Gewicht liegt bei 3,61 g. Dieser sog. Halbstater hat etwa den Wert einer griechischen Drachme (Goldgewicht 3,5 – 4 g). Auf der Vorderseite ist ein nach rechts gewandter Kopf mit Kreispunktauge und Winkelnase abgebildet. Er trägt einen Helm und ist mit 5 Kugeln verziert. Auf der Rückseite sieht man eine stark stilisierte Darstellung der griechischen Göttin des Sieges, der Nike. Sie hat einen Vogelkopf und ist stehend mit ausgebreiteten Flügeln und je zwei Kugeln links und rechts ihrer Schultern dargestellt. Die Tettnanger Münze entsprecht recht genau den kolchischen Exemplaren, weswegen in der Forschung vermutet wird, dass sie von dort stammt. Sie gelangte entweder als Handelsgut vom Kaukasus an den Bodensee, oder als Sold, den ein keltischer Krieger mitgebracht hatte.
Redaktion Pfahlbaumuseum/Jutta-Constanze Arndt, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Römisch Germanisches Zentralmuseum, Mainz
Foto: PM/Schellinger
Überlingen
Von Nordböhmen bis in den Bodenseekreis
Der Weg eines mittelneolithischen Exportschlagers
Die hier präsentierte mittelneolithische Axt (4600-4400 v. Chr.), stammt aus einem der wichtigsten Rohmaterialien des Alt- und Mittelneolithkums – Aktinolith-Hornblendeschiefer (AHS), besser bekannt als Grünschiefer. Der Bonndorfer Landwirt und ehemalige Ortsvorstehen Dieter Veit fand das Objekt auf einem Acker bei Bonndorf, am Waldrand in Richtung Neumühle. Das Beil gelang schließlich über Walter Liehner vom Stadtarchiv Überlingen in das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen.
Das in Mitteleuropa eher selten zu findende und zähe Felsgestein Aktinolith ist ein klassisches Material zur Herstellung alt- und mittelneolithischer Beilklingen. Die 612 Gramm schwere, 13 cm lange und 5,2 cm hohe Axt aus Bonndorf besteht aus diesem Material. Die Farbe des Gesteins ist changierend von schwarz über dunkelgrau bis hellgrau. Das vorliegende Stück ist von hellgrauer Farbe mit gelblichgrüner Patina. Auf der Oberseite ist ein Bohrloch von 2,55 cm, das im Inneren durch den eingesetzten Stiel glanzpoliert ist. Die gesamte Oberfläche ist poliert, weist aber Pflugbeschädigungen auf. An der Oberseite der Schneide ist eine kleine Absplitterung zu erkennen, die im Mittelneolithikum bereits überschliffen wurde. Der Nacken ist abgerundet. Die Bearbeitungsspuren in Form von Schlifffacetten sind zu erkennen. Typologische Vergleiche datieren die Axt in das Mittelneolithikum. Sie ist dementsprechend 6600 bis 6400 Jahre alt.
Fraglich ist woher das verwendete Material kommt und wie es in den Bodenseekreis kam. Das einzig bekannte Abbaugebiet liegt in Jistebsko, im Norden der Tschechischen Republik. Das dortige Vorkommen war vermutlich bereits im Neolithikum bekannt. Ausgewitterter Amphibolit konnte dort einfach abgesammelt werden. Werkzeuge aus diesem Material lassen sich sogar bis in eine Entfernung von 600 km vom Abbaugebiet finden. Für die Bonndorfer Axt ist die Herstellung aus Material von der Abbaustelle in Jistebsko mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Dann bleibt aber die Frage: Auf welchem Weg fand die Axt oder das Rohmaterial ihren Weg in den Bodenseekreis und wie ist dieser Einzelfund zu interpretieren? Als Grund für die Verbreitung des Materials lässt sich kein Mangel desselben anführen. Geeignetes Gestein war vielerorts vorhanden, wurde aber offenbar nicht genutzt. Die Axt könnte als symbolhaftes Gut gedient haben, um den sozialen Stand des Besitzers hervorzuheben. Soziale Unterschiede konnten durch solche Prestigeobjekte ausgedrückt werden. Generell ist die Interpretation solch eines Einzelfundes schwierig. Es wäre natürlich möglich, dass es sich hier um eine Grabbeigabe, ein Siedlungsrelikt oder um eine rituelle Deponierung handelt. Nicht auszuschließen bleibt die These eines Verlustobjekts.
Dominique Gabler,
Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Dieter Veit, Überlingen-Bonndorf
Foto: PM/Schellinger
Uhldingen-Mühlhofen
Mord und Totschlag in Uhldingen-Mühlhofen
Ein altes Skelett liefert neue Erkenntnisse
Eine Kiesgrube am Ortsausgang von Uhldingen-Mühlhofen ist der Fundort des Individuums, welches dort zwischen den Jahren 1930-1940 geborgen wurde. Der Alamanne selbst stammt aufgrund der Beigaben aus dem 6.-7. Jahrhundert n. Chr. und gehört damit in die Merowingerzeit. Das Skelett ist unvollständig überliefert, lediglich Teile des Schädels, drei Halswirbel, Schlüsselbeine, Ober- und Unterarme, Beckenfragmente, Ober- und Unterschenkel sowie wenige Mittelhand- und Mittelfußknochen und einzelne Fingerglieder sind erhalten. Die Langknochenoberflächen sind größtenteils durch die Liegezeit im Boden u.a. durch Wurzelfraß und ein etwas saures Bodenmilieu angegriffen, der Schädel leicht deformiert. Die jeweiligen Gelenkenden der Langknochen sind teilweise verwittert. Es handelt sich bei dem Skelett um einen 25-35-jährigen Mann. Das Geschlecht wurde am Schädel bestimmt, da dieser ausgeprägte Überaugenwülste, eine fliehende Stirn sowie größere Warzenfortsätze und ein ausgeprägtes Nackenfeld besitzt.
Seine Körpergröße beträgt zwischen 1,84 und 1,92 m und sein Körpergewicht betrug zu Lebzeiten 74,3 kg. Die Langknochen sind sehr groß, jedoch auch sehr schlank. Im Gesamteindruck ist das Individuum grazil und sein BMI beträgt 21,9.
Eine feinporöse, siebähnlich-löchrig Läsion und Auflösungserscheinung in den knöchernen Augenhöhlen geben Hinweise auf eine Mangelernährung oder einen Vitaminmangel (Eisen- oder Vitamin C-Mangel). Desweiteren zeigt das gesunde Schienbein im Röntgenbild eine Anzahl feiner horizontaler Linien welche jedes Mal einen Wachstumsstopp der Langknochen bedeuteten und Hinweise auf wiederkehrenden, periodischen Nahrungsmangel, vermutlich im Frühjahr, liefern.
Der beidseitig stärker ausgeprägte Brachialismuskel an der Elle ist für die Beugung des Unterarmes im Ellbogengelenk verantworlich und könnte daher Hinweise auf einen Schwertkämpfer liefern. Auch die Ansatzstelle des großen Brustmuskels am Oberarm ist durch eine beidseitig tiefe Furche von 2-3cm Länge im Knochen sehr ausgeprägt und deutet auf eine starke Brustmuskulatur sowie eine breite Brust zu Lebzeiten hin. Bestimmte Bewegungsabläufe, die durch eine gut ausgeprägte Brustmuskulatur möglich sind deuten auf einen Krieger und/oder Bauern hin.
Ein erhaltener oberer Halswirbel mit Halswirbelkörper liefert Hinweise auf langjährige körperlich harte Arbeit.
Das Individuum weist teilweise starke Konkrementablagerung (Zahnsteinbefall) an den Frontzähnen des Unterkiefers, sowie der rechten Oberkieferhälfte auf, jedoch keine Anzeichen von Karies. Das Individuum hat an einem der oberen Halswirbel eine Bandscheibenentzündung, die aller Wahrscheinlichkeit durch Bakterien hervorgerufen wurde, welche auf den Knochen überging. Der Wirbelkörper zeigt Granulationen und eine unregelmäßige Oberfläche.
Am rechten Oberarm sieht man zerfressene Knochenspongiosa und eine Formveränderung des Knochens mit einer ungewöhnlichen knöchernen Ausziehung nach außen, was auf einen bösartigen Knochentumor, jedoch auch auf einen halbbösen Knochentumor oder eine Knochenzyste hindeuten kann. Auch das Hinterhauptsbein am Schädel zeigt solche Anzeichen einer unregelmäßig veränderten Knochenoberfläche mit Destruktion des Knochens (Anzeichen von Metastasen?).
Der erste Halswirbel zeigt eine Verschiebung der Kontaktflächen zum unteren Halswirbel was auf eine Quetschung zu Lebzeiten hindeuten kann. Desweiteren zeigt er ein gebrochenes Knochenbälkchen links, welches unverheilt ist und auf die unverheilten Hiebverletzung hinweisen könnte.
Die rechte knöcherne Augenhöhle zeigt oberhalb nach außen hin eine scharfkantige Abtrennung. Hierbei handelt es sich um eine unverheilte Hiebverletzung, welche keinerlei Anzeichen einer Heilung erkennen lässt. Diese Verletzung war zwar als solche nicht tödlich, auch wenn das Individuum hierbei sein rechtes Auge einbüßte, sie wurde jedoch nicht lange überlebt, da der Körper keinerlei Selbstheilung vornehmen konnte.
Am rechten Oberarm zeigt sich eine knöcherne Ausziehung nach außen, welche auf einen Trümmerbruch hindeutet. Ob jedoch zuerst ein Knochentumor vorlag und darauf ein Knochenbruch erfolgte oder invers ist nicht mehr nachzuweisen.
Am linken Unterschenkel zeigt sich am unteren Drittel des Knochenschaftes eine deutlich erkennbare Knochenverdickung. Hierbei handelt es sich um eine Schrägfraktur, wobei der Knochen versetzt wieder verheilte, was eine leichte Beinverkürzung von 1-2cm sowie ein leichtes Humpeln zu Lebzeiten als Folgen hatte. Dieser Knochenbruch wurde über einen längeren Zeitraum von mehreren Jahren überlebt.
Eine vorangegangene bösartige Tumorerkrankung und ein geschwächtes Immunsystem schwächten den gesamten Organismus. Schlussendliche Todesursache könnte eine Blutvergiftung aufgrund der unverheilten Hiebverletzung an der rechten knöchernen Augenhöhle gewesen sein.
Text: Isabelle Jasch, Institut für Ur- und Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Pfahlbaumuseum Unteruhldingen
Foto: PM/Schöbel
Uhldingen-Mühlhofen
Neue Erkenntnisse zu den Alamannen
in Uhldingen-Mühlhofen
Eine Zierscheibe aus der Übergangszeit vom Heiden- zum Christentum
Die Zierscheibe besteht aus einer dünnen verzierten Bronzeblechscheibe. Sie wird von einem massiven Eisenring gefasst und ist mit diesem durch elf Buntmetallnieten in dekorativer Anordnung befestigt. Der Eisenring ist mit Silberfädeneinlagen (Tauschierungen) verziert. Details der Scheibenverzierung sind auf der Vorderseite aufgrund der schlechten Erhaltung kaum erkennbar. Auf der Rückseite sind die gepressten Motive noch deutlich zu erkennen. Die kreisrunde Fläche wird durch ein schmales Kreisband mit uniformen, in dichter Folge querstehenden gleichförmigen Strichen im Mittelteil zum Außenrand hin begrenzt.
Im Zentrum des Hauptfeldes ist ein menschliches Gesicht zu sehen, das von einem Kreisband umgeben ist. Das Zentrum umgebende Feld ist mit stark stilisierten, bandförmigen, tierartigen Figuren ausgefüllt, die wiederholt ineinander verschlungen sind. Sie sind im Profil dargestellt und befinden sich in gleicher Ausrichtung zueinander. Die bandförmigen Körper sind jeweils S-förmig gewunden und wie die Kreisbänder ausgeführt. Im Anfangs- und Endbereich sind stark stilisierte Vorder- und Hinterläufe erkennbar. Die Köpfe sind zum Außenrand der Scheibe hin orientiert und blicken nach rechts auf die eigenen Körper. Die Köpfe und Beine sind stilistisch uneinheitlich. Auffällig ist dass das Zentrum der Oberarm- bzw. Oberschenkelbereiche mit einem Kreis bzw. Punkt gefüllt ist. Um jede dieser drei Figuren windet sich jeweils eine weitere Tierfigur in Seitenansicht. Ihr Körper besteht aus Bandmustern, die sich aus zwei bis drei parallelen Linien zusammensetzen. Sie bilden damit einen Kontrast zu dem leiterartigen Bandmuster der S-förmigen Tiere. Sie sind mehrfach selbst ineinander verschlungen und umwinden die S-förmigen Tiere im mittleren Bereich ihrer Körper. Die Umwindung ist auch hier mehrfach und eng. Diese Figuren wirken weniger symmetrisch und verteilen nicht so weit über die jeweilige Fläche. Während die S-förmigen Tiere kompositorisch im Vordergrund zu stehen scheinen, treten die anderen eher „knäuelförmigen” Tierfiguren in den Hintergrund. Eine Artzuweisung der Tiere ist nicht möglich.
Das zentrale Feld wird von einer maskenartigen menschlichen Gesichtsdarstellung (en face) ausgefüllt. Deutlich erkennbar sind die runden Augen und die lange schmale, stilartige Nase. Die darunter W-förmige Linie, jeweils mit gebogenen Segmenten, lässt sich als Bart deuten. Die von der Mitte der Stirn beginnenden und zu Seiten herabfallenden Einzellinien enden spiralförmig-lockenartig nach oben gedreht. An diesen beiden Linien setzen im Stirnbereich in dichten, gleichförmigen Abständen weitere Linien an, die radial nach oben bzw. den Seiten auslaufen. Ob es sich bei letztgenannten um das Haupthaar, eine Krone, Nimbus oder etwas anderes handelt, lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Insgesamt grenzt sich die Figur in ihrer Darstellung deutlich zum Hauptfeld ab.
Die Tauschierung in Form von Pilzzellen und Treppenmuster lässt eine Datierung zum Ende des 6. bis etwa in das erste Drittel des 7. Jahrhunderts n. Chr. zu. Auch die Form des Tierstil II, der ab dem fortgeschrittenen 6. Jh. in Kontinentaleuropa auftritt widerspricht, wenngleich langlebiger, dieser Datierung nicht. Die im Stil II ausgeführten Tiere auf der Hauptfläche werden in der Forschung traditionell mit einer heidnischen Symbolwelt in Verbindung gebracht. Wen der menschliche Kopf im Zentrum darstellt, wissen wir nicht sicher. In Frage kommen Christus und Odin/Wotan.
Auch die Funktionszuweisung des Stückes ist nicht eindeutig. Während es einerseits als Scheibenfibel getragen worden sein könnte, scheint eine Deutung als Teil eines Pferdezaumzeugs ebenso plausibel. Wenn es eine Fibel ist, gehört es in die Gruppe der Pressblechfibeln mit Randschiene, was der oben genannten Datierung entsprechen würde. Allerdings sind keine Spuren eines Spiral- oder Nadelhalters erkennbar. Im Restaurationsbericht von 1942 wird jedoch noch von einem Nadelhalterfragment gesprochen, der an einer Stelle des Eisenringes befestigt war, das bei der Restauration jedoch verloren ging.
Die Gesichtsdarstellung im Zentralfeld findet sich im selben Stil auch bei gepressten Verzierungen im Zentrum von Goldblattkreuzen wiederfindet. Eine Deutung als Christuskopf wird in all diesen Fällen erwogen, scheint aber in der Regel kaum eindeutig möglich. In jeden Fall wird diese Art von Objekten aufgrund ihrer Seltenheit und offenbar recht qualitätvollen Ausführung vermutlich mit einem sozial höher stehenden Personenkreis zu assoziieren sein. Bei der Deutung ist auch die Objektbiographie mit einzubeziehen. So sollte etwa geklärt werden, ob beide Teile des Objektes (Ring und Scheibe) eventuell erst später zusammengebracht wurden und ob mit weiteren Veränderungen zu rechnen ist.
Auf der Rückseite der als frühchristlich gedeuteten Zierscheibe war wohl eine zweite mit rein germanischer Symbolik befestigt. 1942 wird anlässlich einer ersten Restaurierung des Objektes von einer wachsartigen Masse berichtet, die den Hohlraum zwischen den Scheiben ausgefüllt und sie verbunden haben soll. Die rückseitige Scheibe scheint aus Messing zu bestehen und könnte älter als die bronzene der Vorderseite sein.
Text: Isabelle Jasch, Institut für Ur- und Frühgeschichte
und Archäologie des Mittelalters an der Eberhard Karls Universität Tübingen
Leihgeber: Pfahlbaumuseum Unteruhldingen
Foto: PM/Schellinger, Illustration: PM/Josef Englert/Martin Riesenberg
Bermatingen: Volksbank, Markdorfer Straße 7
Daisendorf: Volksbank, im Augustinum, Kurallee 18-22
Deggenhausertal: Volksbank, Im Gewerbegebiet 8 (Untersiggingen)
Eriskirch: Volksbank, Mariabrunner Straße 73
Fischbach: Volksbank, Zeppelinstraße 302
Frickingen: Volksbank, Kirchstraße 25
Friedrichshafen: Volksbank, Ailinger Straße 30
Hagnau: Volksbank, Dr.-Fritz-Zimmermann-Str. 14
Heiligenberg: Sparkasse, Fürstenbergstraße 9
Immenstaad: Volksbank, Meersburger Straße 1
Kressbronn: Volksbank, Hauptstraße 21
Langenargen: Langenargener Bank, Obere Seestraße 3
Markdorf: Volksbank, Hauptstraße 17
Meckenbeuren: GenoBank, Hauptstraße 9
Meersburg: Volksbank, Marktplatz 9
Neukirch: Volksbank, Kirchstr. 8
Oberteuringen: Raiffeisenbank, Raiffeisenstr. 2
Owingen: Rathaus, Hauptstraße 35
Salem: Volksbank, Bahnhofstraße 16
Sipplingen: Volksbank, Rathausstraße 25
Stetten: Rathaus, Schulstraße 18
Tettnang: Volksbank, Lindauer Straße 6
Überlingen: Volksbank, Landungsplatz 11
Uhldingen-Mühlhofen: Pfahlbaumuseum, Strandpromenade 6
Uhldingen-Mühlhofen: Volksbank, Aachstraße 18a